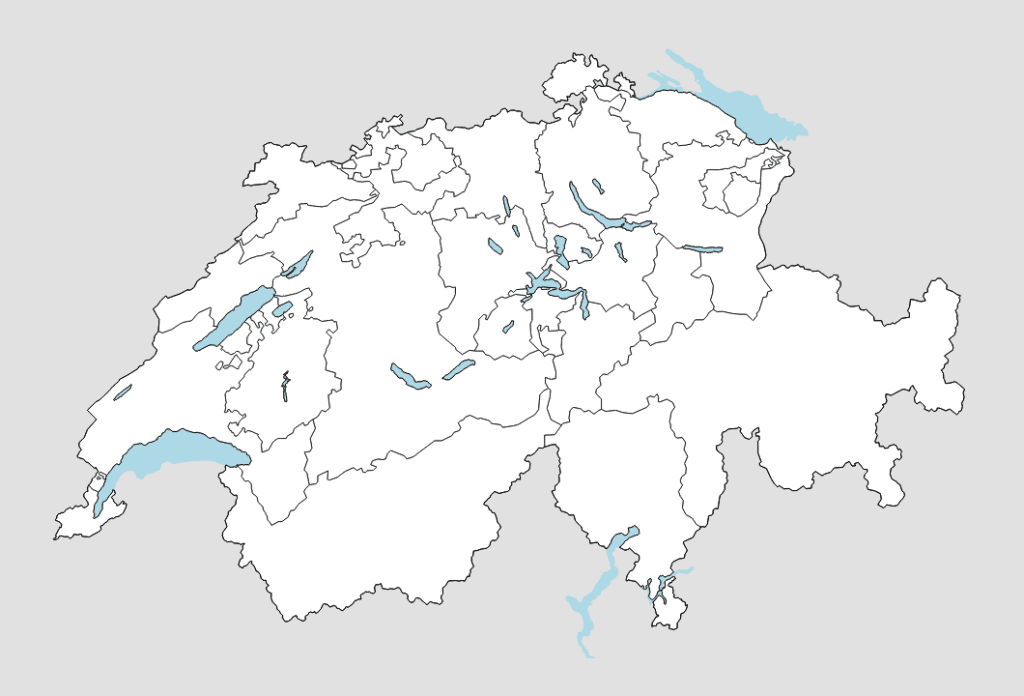Ich war gerade zwischen zwei Sitzungen, als ich per Push-Meldung von den Anschlägen in Brüssel hörte. Den meisten von euch geht es wohl ähnlich. Wir wissen noch, wo wir waren als die Massaker in Paris stattfanden. Oder gar jene 2001 auf die Türme des World Trade Zentrums.
450 Menschen sind seit 9/11 in Europa im Zusammenhang mit Terrorangriffen getötet worden. Das sind definitiv 450 Menschen zu viel. Vor allem, wenn wir auch bedenken, wie gross die Zahl der Verletzten, Traumatisierten und Zurückgebliebenen ist.
Gleichwohl dürfen wir die Relationen nicht verlieren. In der Schweiz sterben pro Jahr rund 1000 Menschen an Selbstmord. Und in Europa sterben pro Jahr 25’000 Menschen an den Folgen von Verkehrsunfällen.
Allein die Zahlen können es nicht sein, die uns Angst machen. Bei jeder Autofahrt setzen wir uns einem vielfach höheren Risiko aus. Doch darum geht es nicht. Es geht nicht um Zahlen, es geht um Wahrnehmung. Die Zahl mag noch so relativiert sein, die Gefahr droht uns zu verschlucken. Wieso das?
„Die Terrorangriffe setzen dort an, wo sich auch die mutigen Leute fürchten, bei der eigenen Ohnmacht.“ Das schreibt Constantin Seibt in einem seiner vielen lesenswerten Beiträge. Unter dem Titel „Fürchte dich nicht“ zeichnet er nach den Anschlägen auf Brüssel auf, wo die eigentlichen Gefahren der Terrorangriffe liegen. Nicht auf der Strasse, sondern bei uns in den Köpfen.
Die Terroristen wollen nicht nur Tod und Leid nach Europa tragen. Sie wollen auch den Hass in unsere Gesellschaft bringen. Die Toten und Verletzten in den Strassen von Paris, Istanbul oder Brüssel sollen uns dazu bringen, die Muslime noch stärker auszugrenzen. Sie wollen unsere Freiheit zerstören, unseren wirtschaftlichen Erfolg schleifen. Sie wollen unsere Herzen kalt werden lassen. Sie wollen Finsternis und Schrecknisse über die Welt bringen, damit das Licht des Jenseits umso heller leuchtet und das Versagen im Diesseits überstrahlt.
Die Wahlerfolge der nationalistischen Rechten ist damit der wohl wichtigste Erfolg für die Totbringer. Je faschistischer die Gesellschaft, desto besser der Nährboden für exakt den Kampf der Kulturen, über den sie junge zornige Männer für ihre fanatischen Wahnsinnstaten rekrutieren können. Les extrêmes se touchent.
Wir wollen aber nicht kaltherzig werden. Wir wollen diesen Hass nicht. Wir wollen die Angst nicht. Wir wollen unsere Freiheit. Wir wollen unsere vielfältige Gesellschaft. Wir wollen unsere Freundschaft zu unseren muslimischen Freundinnen und Freunden.
Jens Stoltenberg, damals Premierminister von Norwegen hat nach den grauenhaften Morden eines Rechtsextremisten in Oslo und Ütoya mit 76 Toten gesagt, was auch heute noch gilt: „Unsere Antwort lautet: mehr Demokratie, mehr Offenheit, mehr Menschlichkeit.”
Genau das muss auch unser Motto sein. Wer jetzt nach totaler Überwachung ruft, gibt unsere Freiheit Preis. Nichts macht uns unfreier als die Angst. Wer geschlossene Grenzen fordert, ruiniert unsere Arbeitsplätze. Und wer jetzt zum Hass auf Andersgläubige aufruft, wird zum Komplizen der Terroristen.
Nicht Angst und Hass dürfen unsere Antwort sein, sondern das Einstehen für die Errungenschaft der Aufklärung. Für Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Haltung ist so wichtig wie schon lange nicht mehr.
Vor vielen Jahren war ich mal auf Studienreise in Schweden. Mich trieb vor allem die Frage um, wie es Schweden schafft, die hohe Zahl an Ausländerinnen und Ausländern in eine so fortschrittliche Gesellschaft zu integrieren. Wer sich für diese Frage interessiert, landet früher oder später in Rinkeby, einem Vorort von Stockholm.
In Rinkeby wohnt niemand, der in Schweden geboren ist. Die damals dominanten Herkunftsländer waren Afghanistan, Pakistan, Irak, Türkei, die Maghreb-Staaten und Äthiopien. Nicht gerade Kulturen, die zum offenen Schweden mit seinem hohen Niveau an Gleichstellung zwischen Mann und Frau passten. Und so kam die Frage: Wie macht ihr das?
Die Antwort war letztlich banal und hiess: „Wir besinnen uns auf das Gemeinsame. Und damit ist Vater Abraham bei uns die wichtigste Figur in der religiösen Diskussion. Er war nämlich der Vater aller drei grossen missionierenden Weltreligionen. Wir sind alle Teil dieser jetzigen, heutigen Gesellschaft. Wir machen sie aus und wir gestalten sie. Und so wissen wir heute aus Erfahrung: Das Verbindende ist viel stärker als das Trennende. Man muss es nur benennen.“
Dieser Fokus aufs Verbindende hat mich seither nie mehr losgelassen. Und ich habe gelernt, dass er vielerorts vieles möglich macht.
Zum Beispiel in der Integrationspolitik. Wir haben doch alle – egal auf welcher politischen Seite wir stehen – ein Interesse daran, dass die Flüchtlinge, die kurz oder länger bleiben werden, Fuss fassen können. Wir haben alle ein Interesse daran, dass sie Arbeit finden oder sich in der Schule rasch zurechtfinden. Wir haben alle ein Interesse daran, dass sie sich der schwierigen Aufgabe stellen, sich in unserer Gesellschaft zurecht zu finden. Und deshalb ist eine zeitgemässe Integrationspolitik ein gemeinsames Anliegen, das weit über die Parteigrenzen hinaus reicht.
Integration ist kein einfacher Prozess. Es geht ums Abschiednehmen und sich Neuem Zuwenden. Es geht um Öffnung und Veränderung. Es geht also genau um das, was jene, die Integration noch heute gerne mit Assimilation verwechseln, selber scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Ja, es ist rasch gesagt, die neu Ankommenden hätten unsere Vorstellung von Gleichberechtigung zu übernehmen. Doch vergessen wird oft, dass jene, die sich bei den Ausländern als Ober-Feministen ausgeben, bei sich selber ganz gut mit traditionellen Wertvorstellungen leben. Und ja, es ist rasch gesagt, der Islam habe ein nicht mehr zeitgemässes Gesellschaftsbild. Doch vergessen geht dabei, dass auch die anderen Weltreligionen im gesellschaftlichen Mittelalter stehen geblieben sind. Oder leben wir so, wie es die Curie in Rom vorschreibt?
Es ist tatsächlich noch nicht lange her, da war das Thema „Integration“ in der Schweiz nicht viel mehr als ein „nice to have“. Etwas, das ein paar Idealistinnen dem Assimilationskonzept der Schweizermacher entgegenstellten. Etwas, das man jenen überliess, die man für ihre Naivität belächeln wollte. Es ist noch nicht lange her und doch tiefe Vergangenheit.
Spätestens, seit den gewaltsamen Anschlägen in vielen Städten dieser Welt ist allen klar: Integrationsarbeit ist ein zentraler Pfeiler der Sicherheitspolitik und damit eine zentrale Aufgabe der öffentlichen Hand. Wer die Integration vernachlässigt, erntet Parallelgesellschaften und Ghettos.
Der Grossraum Zürich ist ein Weltdorf. Er ist ein überaus interessantes und erfreuliches Gemisch von Kulturen, Gewohnheiten, Träumen und Werthaltungen. Spannungen im Zusammenleben der Kulturen sind selten. Es gilt wohl die Feststellung: An kaum einem Ort Europas ist der Anteil der Zugezogenen in der Bevölkerung so gross wie in der Schweiz, das gilt erst recht für den Grossraum Zürich. Und an kaum einem anderen Ort in der Welt funktioniert das Zusammenleben der verschiedenen Kulturen so gut wie hier.
Wie oft wurde schon gesagt, dass es diesmal aber ganz gewiss nicht funktionieren könne. Diese Menschen seien nun wirklich zu verschieden, um in unserer Gesellschaft einen Platz zu finden.
Ich erinnere mich: Als ich Kind war und mit meinen italienischen und spanischen Freundinnen spielen wollte, warnte man meine Eltern vor dem schlechten Einfluss. Die Menschen aus dem südlichen Europa seien einfach zu anders als wir – zu katholisch und zu südländisch.
Als ich später selber in Zürich im Kreis 4 Schule gab und gerade mal ein Kind mit Schweizer Pass in der Klasse hatte, tröstete man mich. Dieses Völkergemisch sei nun wirklich zu fremd und ja auch zu asiatisch – es gab einigen tamilisch Kinder in der Klasse. Und später als meine Kinder im Quartier die Primarschule besuchten und die Mehrzahl ihrer Kollegen aus dem ehemaligen Jugoslawien stammten, schüttelten viele den Kopf ob meiner Begeisterung und meinten zu wissen, dass es diesmal ganz sicher nicht funktionieren würde mit der Integration: Diese Leute seien jetzt wirklich zu muslimisch und zu ländlich.
Immer waren da die warnenden Stimmen, die sicher waren, dass die Integration scheitern werde. Doch immer gab es auch die zuversichtlichen Stimmen. Die Stimmen, die Mut machten. Die Stimmen, die damals schon gesagt haben: Wir schaffen das. Und ja, sie behielten recht. Die Schweiz ist seit über 100 Jahren ein Einwanderungsland: aktuell leben in jedem dritten Haushalt Menschen mit einem Migrationshintergrund. In Basel und in Genf sind sie sogar in der Mehrheit.
Die Zuwanderung hat die Schweiz reich gemacht. Reich im wirtschaftlichen Sinn, aber auch reich an Kultur, an Wissen und Erfahrungen, reich an Möglichkeiten, reich an Vielfalt. Und deshalb an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die noch nicht seit Generationen verschweizert sind: Danke, dass Sie gekommen sind. Und danke, dass Sie geblieben sind.
Zurzeit sind weltweit über 60 Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg, Hunger und Perspektivlosigkeit – so viele wie seit dem zweiten Weltkrieg nicht mehr. Mehr als die Hälfte der Flüchtlinge sind Kinder und Jugendliche.
86 Prozent der Flüchtlinge werden von Entwicklungsländern aufgenommen. Am meisten Flüchtlinge, nämlich 2,5 Millionen Menschen, beherbergt die Türkei. Jordanien hat 1,5 Millionen Menschen aufgenommen. In Libanon lebt über 1 Million Flüchtlinge aus Syrien und das bei einer Bevölkerung von 4 Millionen Menschen.
Statt dass wir wenigstens jenen helfen würden, die helfen, lassen wir diese Staaten mit der gewaltigen Aufgabe ziemlich alleine. Die zugesagten Mittel für die humanitäre Hilfe reichen nirgendwo hin. Und nach dem Willen des bürgerlichen Parlaments sollen jetzt auch noch die Entwicklungshilfegelder gekürzt werden. Statt den Menschen in den fragilen Staaten wie Burkina Faso, Mali, Sudan usw. bessere Perspektiven zu bieten, ziehen wir uns zurück und überlassen das Feld den internationalen Multis zur rücksichtslosen Ausbeutung der Rohstoffe.
Gerade vor kurzem hat der Bundesrat beschlossen, Rüstungsgüter wieder nach Saudi Arabien und weiteren Golfstaaten zu liefern. Die Beteuerungen von wegen, es seien Güter, die nicht in Kriegshandlungen eingesetzt werden, tönen so zynisch, dass wir gerne darauf verzichten würden.
Waffen und Rüstungsgüter finden immer den Weg in die bewaffneten Konflikte. Und die Konflikte sind in der Zwischenzeit miteinander derart eng verknüpft, dass die Söldner von einem Kriegsherd zum anderen ziehen.
Wir sollten uns nicht wundern, dass plötzlich so viele Flüchtlinge den Weg nach Europa suchen. Wir sollten uns eigentlich nur darüber wundern, dass sie es nicht schon früher taten. Und dennoch: Auch wenn die Bilder einen anderen Eindruck erwecken: Letztlich ist es auch heute nur ein ganz kleiner Teil der Flüchtlinge, der es bis zu uns schafft. Europa hat letztes Jahr 1 Million Flüchtlinge aufgenommen, das sind 0,26 Prozent der europäischen Bevölkerung. Wenn wir hier tausend Leute wären, wären darunter weniger als 2,6 Flüchtlinge.
Ende Januar 2016 waren im Grossraum Zürich 11300 Personen im Asylprozess. Auch das ist 100 Mal weniger als der Libanon aufnimmt, nämlich 0,25 Prozent bei uns im Vergleich zu 25 Prozent wie im Libanon. Aber immerhin: Der Grossraum Zürich bietet rund 10’000 vorläufig aufgenommenen oder anerkannten Flüchtlingen Schutz und Gelegenheit zur Entwicklung. Rund 90 Prozent der vorläufig aufgenommenen und anerkannten Flüchtlinge werden hier in der Schweiz bleiben. Gelungene Integration ist damit auch künftig im Interesse aller.
Lassen wir uns hier von den gemeinsamen Interessen leiten: Investieren wir rasch in die Schulen und unterstützen wir die Lehrkräfte bei der anspruchsvollen Aufgabe. Verstärken wir die Anstrengungen, damit die Flüchtlinge rascher eine Arbeit finden und leisten wir einen ganz direkten Beitrag als Zivilgesellschaft. Dort, wo Flüchtlingskinder für die Pfadi gewonnen werden können oder wo eine eritreische Mutter im Kirchenchor mitsingt, geschieht Integration quasi von allein.
Wir erleben bedeutende Momente europäischer Geschichte. Und wir erleben ein Europa, das tief gespalten ist. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie unser Kontinent ohne die disziplinierenden EU-Verträge auf die gegenwärtigen Krisen reagieren würde.
Es waren die schockierenden und unendlich traurigen Bilder des kleinen Ailan, die uns mit unserer ganz persönlichen Menschlichkeit konfrontierte. Tausende von Freiwilligen machten sich auf den Weg. Sie sorgen seither auf der Balkanroute oder auf den griechischen Inseln dafür, dass die Flüchtlinge nicht gerade vor den laufenden Kameras verhungern oder erfrieren. Wird es dieses Engagement sein, das uns davor bewahrt, uns vor der Geschichte fürs Zuschauen zu schämen?
Es waren aber auch die ebenso schockierenden Bilder der brennenden Asylunterkünfte, die uns weckten. Und wir müssen wach bleiben. Denn immer mehr Länder riegeln sich ab, immer mehr Zäune werden errichtet und immer wieder brennen Flüchtlingsunterkünfte.
Schauen wir diesem Treiben nicht zu. Denn die Geschichte lehrt uns: Rassismus darf man nicht verstehen. Man muss ihm entgegentreten und zwar in aller Klarheit. So wie die preisgekrönte deutsche Journalistin Dunja Hayali es in ihrer Preisrede zusammenfasste: “Und nun wende ich mich noch an alle, die ständig sagen, man dürfe wohl noch sagen, was man denke, ohne dass man dafür gleich als Rassist beschimpft werde. Ich sage Ihnen hier deutsch und deutlich: Wenn Sie sich rassistisch äussern, dann sind Sie verdammt noch mal ein Rassist.”
Um der braunen Wand Einhalt zu gebieten, werden wir in ganz Europa und auch in der Schweiz alle Kräfte brauchen, die sich für Anstand, Respekt und Menschlichkeit einsetzen. Errungenschaften wie der Rechtsstaat, die Menschenrechte, die Gewaltenteilung oder auch die völkerrechtlichen Verträge sind keine abstrakten Werte, deren Verteidigung man den Professoren an den Universitäten überlassen kann. Nein, wir alle müssen sie jeden Tag und in jeder Situation verteidigen. Sie sind die Säulen des über 70 jährigen Friedens, den wir in Europa geniessen dürfen.
Doch belassen wir es nicht bei Worten.
- Korrigieren wir konsequent in Gesprächen mit Bekannten rassistisch angehauchte Aussagen.
- Spenden wir Geld und helfen wir wenigstens jenen, die helfen.
- Sprechen wir den Flüchtling an, der verloren am Bahnhof steht.
- Überlegen wir dort, wo wir aktiv sind, ob wir Flüchtlingen Gelegenheit bieten wollen, bei uns mitzumachen: Im Fussballclub, im Kirchenchor, in der Pfadi, in der Partei oder in der Gewerkschaft.
Wir müssen dort anknüpfen, wo das moderne Europa entstanden ist: bei der Solidarität. „Krisen können nur gemeinsam bewältigt werden.“ Dieses Axiom der jüngeren europäischen Geschichte hat seine Wurzeln in den Trümmern und der Zerstörung der beiden Weltkriege.
Bei vielen Menschen hat sich Axiom tief und beständig in die Seele eingeschrieben. Es war diese Solidarität, die dem Wort Willkommenskultur im letzten Herbst am Bahnhof München Leben einhauchte. Die strahlende Polizistin, die ein kleines erschöpftes Mädchen an der Hand führt. Der lachende Bahnarbeiter, der dem syrischen Jungen seine Mütze auf den Kopf setzt. Die Helferin, die der erschöpften, dankbar lächelnden Mutter bei der Versorgung ihrer Kleinkinder hilft. Erschöpfung mischte sich mit Dankbarkeit, Professionalität mit Menschlichkeit.
Diese Bilder entlarven die Angstmacherei. Sie sprechen ihre eigene Sprache und zeigen, dass wir gut daran tun, die Flüchtlinge mit einem menschlichen Willkommen zu empfangen. Die Flüchtlinge werden die schützenden, applaudierenden Hände nicht vergessen. Sie (und damit meine ich die grosse Mehrheit) werden ihren Kindern immer und immer wieder von der Hilfsbereitschaft der Menschen an den Bahnhöfen erzählen. Es wird Teil ihres Stolzes und ihrer neuen Identität werden, das Willkommen zu entgelten. Sie werden sich Mühe geben, das Gastland und die Menschen, die ihnen geholfen haben, zu ehren. Und sich deshalb um eine rasche Integration bemühen.
Vor einem Monat besuchte ich die Abschiedsvorstellung des sogenannten Montagchors. 500 Menschen, darunter 400 Flüchtlinge haben in den vergangenen Monaten jeweils am Montag unter Leitung des grossartigen Christoph Homberger ein wunderbares Konzert einstudiert. Die Kraft der Musik und des Gesangs liess mich in Gedanken nach Rinkeby zurückreisen, in die Schule im Vorort von Stockholm, in der konsequent nach dem Verbindenden gesucht wird.
Wir wollen weiterhin in einer freien, offenen und solidarischen Gesellschaft leben. Weil in einer solchen Gesellschaft das Leben schön und spannend ist. Weil Kaltherzigkeit kein gutes Lebensgefühl ist. Weil Hass und Angst das zerstören, was wir zu verteidigen glauben. Lasst uns deshalb Haltung zeigen. Sie ist so wichtig wie schon lange nicht mehr.