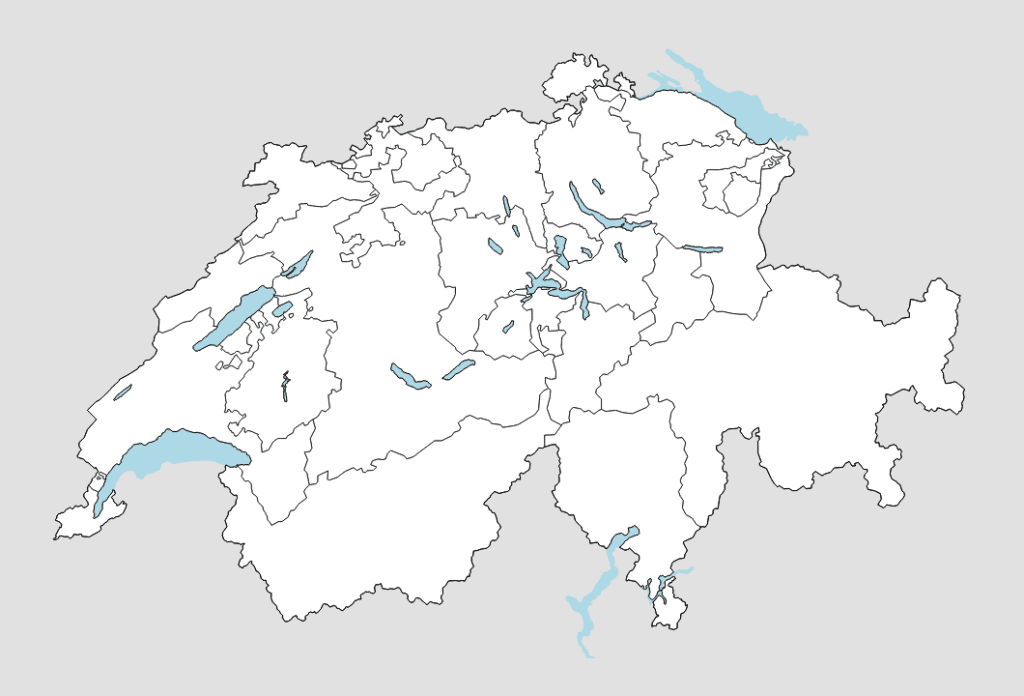Blickt die UNO auf ihre 75-jährige Geschichte zurück, fällt die Bilanz durchmischt aus. Mit Inkrafttreten der UNO-Charta haben sich die Mitgliedstaaten zum Ziel gesetzt, gemeinsam und in geteilter Verantwortung – eben multilateral – für internationale Sicherheit, Kooperation und Frieden zu sorgen. Durch die Charta sollte vor allem verhindert werden, dass sich die Welt erneut in einen globalen Krieg stürzt. Der UNO ist es beispielsweise während der Kuba-Krise im Kalten Krieg gelungen, mittels der Strategie der Friedenssicherung, die auf Deeskalation und ein Gewaltverbot setzte, zwischen zwei Grossmächten zu vermitteln und den Ausbruch eines «heissen» Kriegs zu verhindern. Gleichzeitig lässt sich der Vorwurf schlecht abstreiten, dass die UNO zu wenig demokratische Legitimation und nicht genügend Kompetenzen hat, um rechtlich bindende Entscheidungen zu treffen, die innerhalb der Nationalstaaten auch durchgesetzt werden können. Zudem können die Grossmächte durch ihr Veto im Sicherheitsrat Beschlüsse blockieren und haben somit innerhalb der UNO überproportional viel Macht.
Diese Probleme liegen jedoch nicht primär bei der UNO, sondern vorwiegend bei den Mitgliedsstaaten. Nationalstaaten geben ihre Macht nur ungern ab. Heute noch weniger als früher. Es gibt also definitiv keine «Weltregierung» der UNO. Es liegt an den Nationalstaaten, sich international zu koordinieren. Die UNO ist ein Versuch, der internationalen Staatengemeinschaft Rechte zu verleihen und Pflichten aufzuerlegen, an die sich alle halten müssen. Daraus hat sich über die Jahrzehnte ein praktischer Universalismus entwickelt. Dieser ist auf vielen Ebenen unperfekt – aber gleichzeitig revolutionär. Denn die Etablierung internationaler Rechtsnormen gibt jedem einzelnen Menschen auf unserem Planeten das Recht, seinen Schutz, seine Sicherheit und seine Würde einzufordern – unabhängig von seinem Geschlecht, seiner Klasse oder seiner Herkunft. Diese Rechte bleiben allerdings so lange zahnlos, wie sie von niemandem durchgesetzt werden können. Klima-Krise, Corona-Krise und der erstarkende Nationalismus machen deutlich, wie zentral die Durchsetzung gemeinsamer Regeln ist. Nur so sind die enormen Probleme unserer Zeit zu lösen. Um die UNO zu stärken, braucht es mehr und nicht weniger davon!
Die Schweiz setzt sich auf Druck der SP deshalb seit Jahren für eine Reform der UNO sowie eine Stärkung und Weiterentwicklung des Völkerrechts ein. Seit dem Amtsantritt von Aussenminister Cassis stockt dieser Reform-Elan allerdings gewaltig: Bei der Deklaration zum Schutz der Zivilbevölkerung in städtischen Gebieten wird gemauert, bei der UNO-Organisation für die palästinensischen Flüchtlinge (UNRWA) Geschirr zerschlagen, der UNO-Migrationspakt sabotiert und der Atomwaffenverbotsvertrag nicht unterschrieben. Diese schleichende Abwendung des schweizerischen Aussenministers vom Multilateralismus und vom Prinzip der geteilten Verantwortung ist verheerend – für das Image der Schweiz und auch für die Lösung globaler Probleme. Die Kandidatur der Schweiz für die Einsitznahme im Sicherheitsrat in den Jahren 2023/24 bietet dagegen die Chance, dem Wirken der Schweiz in den UNO-Organisationen wieder neuen Schwung zu verleihen.
Die UNO hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie den Frieden fördern kann. Gleichzeitig hat die Corona-Krise einmal mehr verdeutlicht, dass ihre Strukturen und Entscheidungsprozesse modernisiert und demokratisiert werden müssen. Etwa über eine parlamentarische Versammlung, wie sie der Ständerat auf Antrag von SP-Ständerat Daniel Jositsch einstimmig fordert. Auch die Entscheidungsprozesse und Verantwortlichkeiten müssen reformiert werden, damit Verletzungen des Völkerrechts aktiv geahndet werden.
Nur durch eine starke UNO und einen neuen, fairen und inklusiven Multilateralismus können soziale und ökologische Gerechtigkeit erreicht werden. Zum 75. Geburtstag der UNO wünschen wir uns mehr davon! So wie es die Progressive Allianz heute in New York im Vorfeld einer Tagung der Foundation for European Progressive Studies (FEPS) fordert. Im Interesse von Frieden, Sicherheit und nachhaltiger Entwicklung für die Welt.
Fabian Molina und Jon Pult, Nationalräte SP