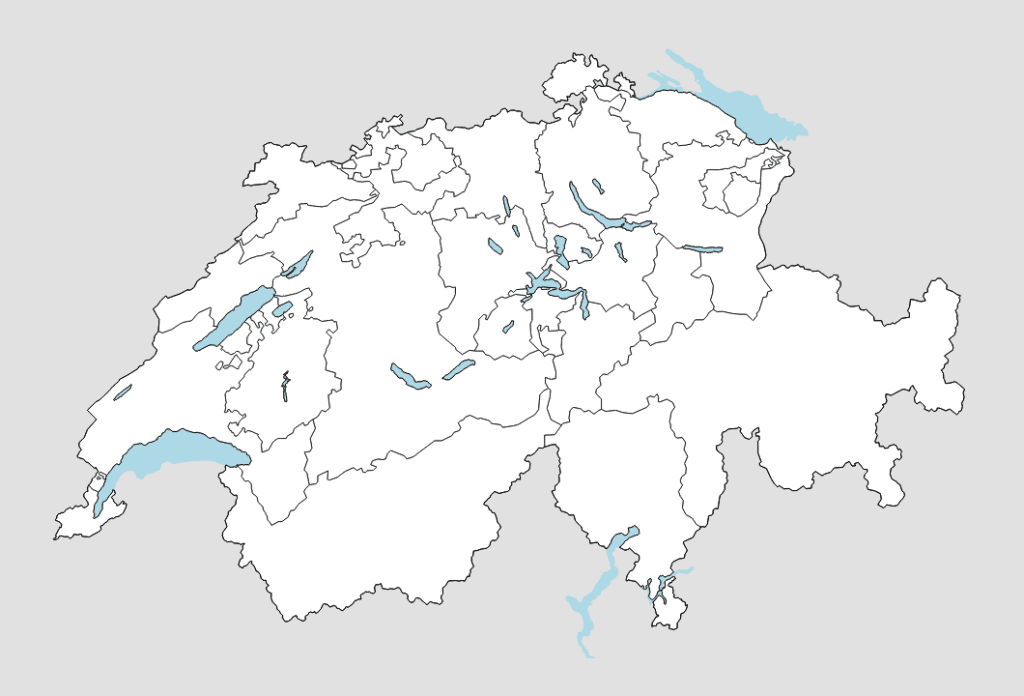Uns droht ein Zeitalter des Faschismus. Wie ein Virus infiziert er die westlichen Demokratien. Die Wurzeln dieses Übels liegen im Neoliberalismus – er brachte extreme Ungleichheit, sozialen Abstieg und Zukunftsängste. Deshalb müssen die demokratischen Kräfte genau hier ansetzen: den Faschismus bekämpfen – mit einer sozial gerechten Wirtschaftspolitik und einer fairen Verteilung des Wohlstandes. So würde ihm der Nährboden entzogen.
Von Walter Langenegger
Die Entwicklung ist furchterregend: Ein europäisches Land nach dem anderen fällt der extremen Rechten in die Hände. Flackerte der Faschismus nach der Jahrtausendwende zunächst meist nur in den ehemaligen Ostblockstaaten auf, so ist heute Westeuropa Opfer seines Vormarsches – ausgerechnet jener Teil des Kontinents also, der glaubte, die Lehren aus Nationalsozialismus und Rechtsextremismus gezogen zu haben.
Beflügelt durch Donald Trumps Wahl zum US-Präsidenten, rufen Europas Faschisten denn auch bereits ein neues, autoritäres Zeitalter aus – ein Zeitalter der kruden Machtpolitik, der nichts heilig ist. Weder Freiheit noch Fairness. Weder Menschenrechte noch Selbstbestimmung. Weder Umwelt noch Klima. Nichts.
Helfershelfer des Faschismus
Ihre Helfershelfer sind dabei stets die gleichen: die etablierten konservativen und bürgerlichen Parteien. Ob in Italien, Schweden, den Niederlanden oder Deutschland – überall verabschieden sich die einst vermeintlichen Garanten von Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechten von ihren Prinzipien, koalieren mit rechtsextremen Parteien und ebnen ihnen den Weg zur Macht und in die Mitte der Gesellschaft.
Die Brandmauer gegen den Faschismus entpuppt sich als Illusion. Im Zweifelsfall marschieren die bürgerlichen Kräfte lieber mit illiberalen Parteien, als sich mit der demokratischen Linken zu verbünden. Denn in einem zentralen Politikfeld unterscheiden sich Bürgerliche und Rechtsextreme kaum: Beide vertreten eine Wirtschaftspolitik, die auf Marktradikalität beruht, Unternehmen und Kapital freie Hand gewährt und ein Staatskonzept propagiert, das die öffentliche Hand als Erfüllungsgehilfin der Wirtschaftsinteressen sieht – notfalls auch auf Kosten der Bevölkerung und der Ökologie.
Katastrophe mit Ansage
Darum erstaunt es nicht, dass der Virus des Faschismus heute epidemisch auftritt. Die Katastrophe war bereits kurz nach dem Zusammenbruch des Sowjetkommunismus voraussehbar. Denn mit ihm trat eine neue Verheissung auf den Plan, vor der Kritiker lange vergeblich gewarnt hatten: die Ideologie des Neoliberalismus. Ihr trügerisches Versprechen: Wohlstand durch Entfesselung der Marktkräfte, freien Handel sowie rigorosen Steuer- und Staatsabbau.
Heute wissen wir: Der Neoliberalismus schaffte zwar Wachstum, aber noch mehr schuf er ungeheure Ungleichheit mit vielen Verlierern und wenigen Gewinnern. Die Profiteure sind in extremem Masse Banken, Konzerne und Tech-Giganten, kapitalstarke Investoren, Megareiche und Erbschaftsmilliardäre. Sie bilden einen neuen Geldadel, wie es ihn nie zuvor gegeben hat. Sie sind unvorstellbar reich, üben oft ohne demokratische Legitimation politische Macht aus und konditionieren das Leben von Milliarden Menschen.
Musk – die Spitze der Absurdität
Diese Absurdität personifiziert sich in Elon Musk: Ausgestattet mit 400 Milliarden Dollar Vermögen und faschistoiden Allmachtsfantasien berauscht er sich derzeit daran, die Demokratie und ihre Institutionen in den USA zu zertrümmern. Selbst ein Produkt des Neoliberalismus, läutet Musk nun dessen letzte Phase ein und macht ihn vollends zum Werkzeug von Willkürherrschaft und Autokratie.
Die Mär vom «Wandel durch Handel»
Autokratie pur ist auch das, was der Neoliberalismus global angerichtet hat. Einst stellte er mit der Formel «Wandel durch Handel» in Aussicht, dass die Welt dank wirtschaftlichen Austauschs mit autoritären Regimen demokratischer und sicherer werde. Doch das Gegenteil geschah: Der Neoliberalismus brachte Staaten wie China, Russland und Indien Investitionen, Arbeitsplätze und Technologie – aber keinen Geisteswandel. Je reicher sie wurden, desto totalitärer und antidemokratischer wurden sie.
Gleichzeitig hat der Neoliberalismus den Westen enorm verletzlich gemacht. Die Abhängigkeit der Demokratien von Autokratien hat sich erhöht – und nicht umgekehrt, wie versprochen. Die Autokratien sitzen oft am längeren Hebel – etwa Russland mit seinen Rohstoffen oder China mit seiner Fertigungsindustrie – und missbrauchen den Zugang zum Weltmarkt, um ihre politische und militärische Hegemonie auszubauen.
Gebeutelte Mittelschicht im Westen
Den höchsten und schmerzhaftesten Preis für den Neoliberalismus aber zahlte die breite Bevölkerung in den Ländern des Westens – insbesondere die untere Mittelschicht mit bescheidener Bildung und mässigen Berufschancen: von der Verkäuferin über die Serviceangestellte bis zur Reinigungskraft, vom Chauffeur über den Logistiker und den Krankenpfleger bis hin zur Fachkraft sowie dem Kleinunternehmer und den Selbständigerwerbenden. Sie sind die grossen Verlierer von Deregulierung, Privatisierung und Globalisierung.
Dies geschah einerseits, indem Abermillionen einst ordentlich bezahlter Jobs in der Industrie und im Dienstleistungssektor in Billiglohnländer des Südens und des Ostens verlagert wurden. Und andererseits, indem die neoliberale Politik die Zuwanderung von Menschen aus armen Ländern in die reichen Volkswirtschaften befeuerte – was vor allem in jenen Staaten zu Lohndruck und Konkurrenz führte, die keine sozialen Massnahmen zum Schutz des Arbeitsmarktes ergriffen.
In der Europäischen Union verlief dieser Prozess schleichend und führte zu stagnierenden Einkommen, Jugendarbeitslosigkeit und wachsender Prekarisierung. In den USA, mit einer traditionell ohnehin schwachen sozialen Absicherung, traf es die Mittelschicht mit voller Wucht – insbesondere im Rostgürtel. Auslagerung, Outsourcing und der Ausverkauf ganzer Industriezweige hinterliessen Fabrikruinen, Massenarbeitslosigkeit und wachsende Verzweiflung.
Komplizen im Ungeist
Das ist fatal für wohlhabende, demokratische Gesellschaften. Wer trotz Arbeit und Fleiss nicht vom Fleck kommt, fühlt sich gedemütigt. Wer fürchtet, dass es seinen Kindern dereinst nicht besser, sondern schlechter gehen wird, verliert den Glauben an die Zukunft. Und wer sozial absteigt und Angst haben muss, sein Stückchen Wohlstand zu verlieren, sucht Schuldige. So wird die Demokratie von innen heraus zersetzt und die Menschen werden anfällig für autoritäre Politik. Genau das ist der Nährboden, auf dem Faschismus wächst.
Der Neoliberalismus entpuppt sich damit als Komplize des Faschismus. Was er gesät hat, erntet nun der andere: beängstigende Wahlsiege, die aus dem Gefühl vieler Menschen entstehen, bedroht zu sein und nicht das zu erhalten, was ihnen zusteht. Das ist die Wunde, in die der Faschismus hineinsticht, indem er verspricht, die Kontrolle über das eigene Leben und das eigene Land zurückzuholen und die vermeintlich Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.
Die Lüge des Faschismus
Doch das ist eine Lüge. Der Faschismus bringt keine Heilung, sondern Verblendung. Er benennt die wahren wirtschaftspolitischen Ursachen nicht, die zu Migration, Verlustängsten und sozialem Abstieg führen, sondern lenkt vielmehr davon ab. Er tut dies, indem er eine angeblich homogene Mehrheit von «normalen, hart arbeitenden Menschen» als Opfer von Minderheiten darstellt: von ethnischen, geschlechtlichen und politischen Gruppen, die der Mehrheit vermeintlich einen anderen Lebensstil aufzwingen und sie ausnutzen wollen. Das ist das toxische Narrativ des Faschismus.
Das funktioniert – und zwar leider fürchterlich gut. Die Hetze gegen Migrantinnen und Migranten, Flüchtlinge, queere Menschen, Feministinnen und «Links-Grün-Versiffte» sowie gegen LGBTQ, Wokeness, Anti-Rassismus und «MeToo» liefert Sündenböcke und suggeriert, dass sich diese Gruppen Ansprüche und Rechte herausnehmen würden, die die Mehrheit benachteiligten und deren Leben verschlechterten. Und je schriller die Debatte darüber tobt, desto mehr verdichtet sich bei vielen, vorab enttäuschten und unpolitischen Menschen der Anschein, dass dem tatsächlich so ist.
Das macht es schwierig, den Faschismus bei diesen Themen zu bekämpfen. Migration ist seit jeher ein Reizthema für Gesellschaften, die unter Druck stehen und mit Ungleichheit und Wohlstandsgefälle ringen. Und die Anliegen von ethnischen, gesellschaftlichen und sexuellen Minderheiten sind – mögen sie noch so legitim und gerechtfertigt sein – vom Alltagsleben der Mehrheit der Menschen meist so weit entfernt, dass sie oft auf Unverständnis stossen und provokativ wirken. Beides ist somit prädestiniert für rechtsextremen Populismus.
Faschismus demaskieren
Umso mehr sind die demokratischen Kräfte gefordert, den Faschismus auf ein anderes Terrain zu zwingen – nämlich dorthin, wo die tatsächlichen Sorgen der breiten Bevölkerung liegen: bei stagnierenden Löhnen, schwindender Kaufkraft, Wohnungsnot, steigenden Mieten, wachsenden Lebenshaltungs- und Gesundheitskosten, sinkenden Renten und dem fortschreitenden Abbau des Service public. Hier, bei diesen Themen, liegen die Mehrheiten, die es braucht, um die Demokratie zu verteidigen und den Faschismus zu stoppen.
Den Menschen muss bewusst gemacht werden, dass ihr diffuses Unbehagen berechtigt ist – dass die Ursachen jedoch nicht in Migration, Kulturkampf und Identitätspolitik liegen, sondern in einer Wirtschaftsordnung, die den von uns allen gemeinsam erwirtschafteten Wohlstand immer ungleicher verteilt und in die Hände einer kleinen Oberschicht lenkt. Deshalb muss der öffentliche Diskurs viel stärker auf Fragen der Verteilungsgerechtigkeit ausgerichtet und offengelegt werden, woran das System in Tat und Wahrheit krankt.
Gelingt dies, wird der Faschismus demaskiert. Denn dann muss er erklären, weshalb er die Migration verteufelt, nicht aber die Wirtschaft, die die Zuwanderung erst verursacht – weil sie lieber günstiges Personal aus dem Ausland einstellt als Einheimische. Oder warum er stets vom «arbeitenden Volk» spricht, aber nichts gegen Lohndumping unternimmt, stattdessen jedoch Mindestlöhne und Tarifverträge bekämpft. Oder warum er der Mittelschicht den Abbau von Renten und öffentlichen Dienstleistungen zumutet, während er Milliardären und der finanzstarken Oberschicht Steuerprivilegien gewährt.
Das Portemonnaie zählt
Wer es daher ernst meint mit der Verteidigung der Demokratie, fordert zuallererst eine soziale Wirtschaftspolitik oder das, was man früher, zu Westeuropas besseren Zeiten, soziale Marktwirtschaft nannte. Eine Wirtschaftspolitik, die mit einer Rückverteilung von oben nach unten, einem gerechten Steuersystem und einer Disziplinierung der Konzerne dafür sorgt, dass den Leuten mit normalem Einkommen am Ende des Monats mehr Geld in der Tasche bleibt, dass ihre Kinder eine gute Ausbildung bekommen, die Grosseltern eine anständige Rente haben und der Staat da ist, wenn man ihn braucht. Eine solche Politik brächte das Grundvertrauen und den Zukunftsglauben zurück, die der Neoliberalismus zerstört hat, und wäre die dringend benötigte kraftvolle Antwort auf den Faschismus.
Joe Biden, wohl der beste US-Präsident der jüngeren Zeit, hatte das erkannt: Er brach mit der Marktgläubigkeit und lancierte eine keynesianische Wirtschaftspolitik mit Milliardeninvestitionen in Infrastruktur und Klimaschutz sowie der Förderung der Mittelschicht. Doch sein Pech war, dass er zu spät kam und Präsident einer Nation war, die durch den Faschismus und den Kulturkampf der radikalisierten Republikaner demokratiepolitisch und intellektuell bereits zu stark vergiftet und zerrüttet worden ist.
Die «Fünfte Kolonne» in Europa
Dasselbe Schicksal droht auch Europa. Trumps rechtsextreme «Fünfte Kolonne» marschiert bedrohlich voran, angeführt von Orbán, Meloni, Kickl, Weidel, Wilders, Le Pen und Farage. Sie säen Zwietracht, spalten die Gesellschaft und ködern eine gebeutelte Mittel- und Unterschicht mit dem Versprechen von nationaler Grösse, während sie hinter den Kulissen mit Konzernen, Geldadel und einflussreichen Eliten paktieren – ganz so, wie es der Faschismus schon vor 80 Jahren tat.
Noch stemmt sich ein erheblicher Teil der Bevölkerung gegen den Rückfall in eine dunkle Zukunft. Dass die soziale Gerechtigkeit dabei eine wirksame Waffe ist, belegt nicht zuletzt die stockbürgerliche Schweiz: In der jüngsten Zeit gelang es, mit Initiativen zur Gesundheitsversorgung, zum Lohnschutz und zur Altersvorsorge sowie mit Referenden gegen den Abbau von Renten und Mieterschutz breite Unterstützung für Elemente einer sozialen Wirtschaftspolitik zu gewinnen – und dies trotz des Widerstands eines immer aggressiver agierenden rechten Mehrheitsblocks aus SVP und FDP.
Doch die Zeit drängt: Das Tor zur Hölle wird sich in Europa nur dann nicht weiter öffnen, wenn die Linke sich nicht in fruchtlosen Kulturkämpfen verstricken lässt und wenn in der demokratischen Mitte endlich die Erkenntnis reift, dass die Politik nicht danach zu fragen hat, was Konzerne, Lobbygruppen und Superreiche wollen, sondern einzig, was dem realen Wohl der breiten Bevölkerung und ihrem Wunsch nach einem normalen Leben in Würde und in materieller Sicherheit dient.
Das ist die simple Wahrheit: Entweder erhalten die Enttäuschten und Verlierer des Neoliberalismus in den westlichen Ländern wieder einen grösseren Anteil am gesellschaftlichen Wohlstand – oder sie werden endgültig zum Fussvolk des Faschismus.
Dieser Beitrag ist zuerst im Februar 2025 auf dem Blog von Walter Langenegger erschienen.