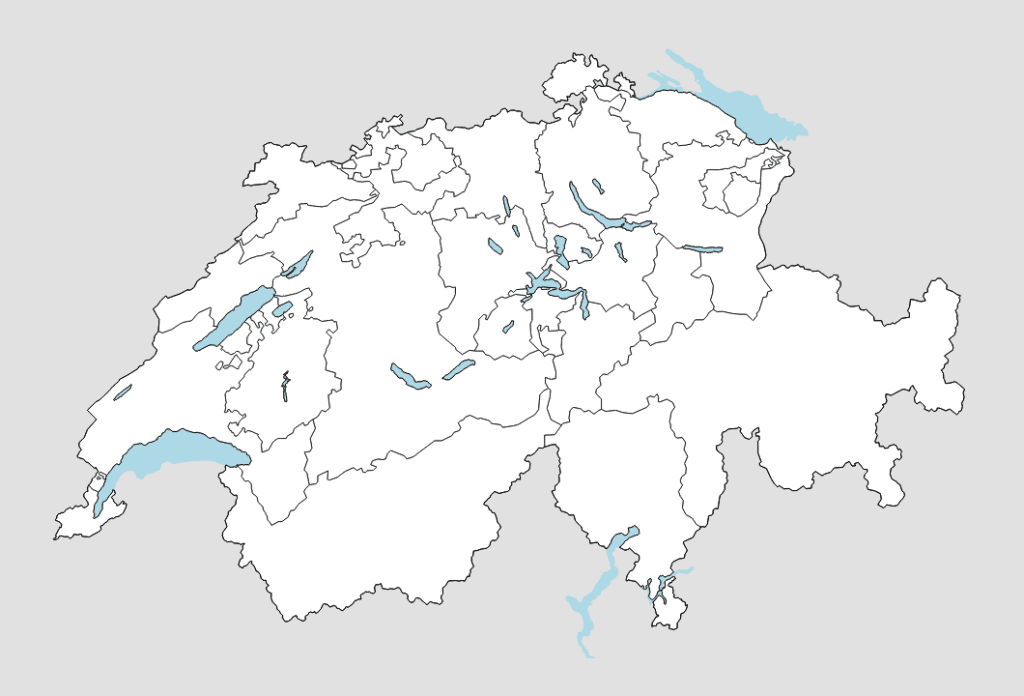Spätestens seit 2008 dürfte allen klar sein, dass sich unsere Welt in einem unhaltbaren Zustand der Dauerkrisen befindet. Die Politik scheint komplett überfordert: Finanzkrise, Wirtschaftskrise, Klimakrise, Flüchtlingskrise… Und immer klarer wird auch, dass diese Krisen alle mit der gigantischen Umverteilung von Chancen und Risiken in und zwischen den Gesellschaften zu tun haben. Der globale Kapitalismus führt zu krassen Ungleichheiten. Laut einem Bericht der britischen NGO Oxfam besitzen 62 Superreiche gleich viel Vermögen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, also wie 3.6 Milliarden Menschen. Das reichste Prozent der Weltbevölkerung kontrolliert mehr Vermögen als die restlichen 99% zusammen. Und in unseren Gesellschaften sieht es nicht anders aus. Besassen die 300 reichsten Schweizerinnen und Schweiz im Jahre 2000 noch 374 Milliarden, sind es heute bereits 600 Milliarden.
Die Menschen haben den berechtigten Eindruck, dass sie immer weniger vom Kuchen haben und dass sie immer weniger kontrollieren können, was um sie herum passiert. Die politische und wirtschaftliche Elite teilt den Kuchen in Davos und an der Wallstreet offensichtlich sehr einseitig auf. Gleichzeitig hat die neoliberale Managerialisierung der Wirtschaft das Arbeitsumfeld für viele verändert. Der Ton wird rauer; Wertschätzung, Fairness, Teilhabe auf Augenhöhe – viel zu oft kommen diese eigentlich selbstverständlichen Verhaltensweisen zu kurz, weil von oben herab durchregiert wird und kurzfristige Profitziele dominieren. Gerade vor zwei Wochen habe ich wieder jemanden kennen gelernt, der seinen Job bei einem florierenden Schweizer Unternehmen nach 40 Jahren verloren hat – mit 62 Jahren. Er war zu teuer für die ehrgeizigen Gewinnziele. Noch vor 30 Jahren wäre das undenkbar gewesen. Das aktuelle «Barometer Gute Arbeit» der Berner Fachhochschule und der Gewerkschaft Travail.Suisse kommt zum selben Schluss: Stress und psychosoziale Belastung am Arbeitsplatz nehmen zu, immer mehr Arbeitnehmende zweifeln am Sinn ihrer Arbeitsstelle.
Diese Ohnmacht und Enttäuschungen führen – im «besseren Falle» – zu Politikabstinenz. Im schlechteren Falle werden sie absurderweise von selbst ernannten Volkstribunen wie Berlusconi, Trump oder Blocher aufgefangen. Ihr Rezept ist einfach. Schuld sind immer die anderen: Brüssel, Scheininvaliden, Ausländer, Flüchtlinge. Vorzugsweise jene, die sowieso schon einen schwierigen Stand haben in unserer Gesellschaft.
Mit dem Konzept der Wirtschaftsdemokratie geht die SP einen mutigen wie auch logischen Schritt vorwärts. Die Ungleichheit an politischer und wirtschaftlicher Macht liegt in den Besitzverhältnissen begründet. Das ist so banal wie einleuchtend: Wer das Aktienkapital einer Firma kontrolliert, verfügt über einen massgeblichen Einfluss auf das Leben von Tausenden von Angestellten, Konsumentinnen und Konsumenten oder Bürgerinnen und Bürgern. Zu viel wirtschaftliche Macht in wenigen Händen kann zudem schnell in politische Macht umschlagen. Das sehen wir aktuell wieder bei der Unternehmenssteuerreform III: Manager und Multis drohen, die Produktion zu verlagern, wenn sie nicht weitere saftige Steuergeschenke erhalten.
Wer das Primat der Politik wieder herstellen will, muss die Kontrolle über unsere Wirtschaft demokratisieren. Es kann nicht mehr länger sein, dass über die Köpfe und Interessen der Menschen hinweg entschieden wird. Insbesondere die Mitarbeitenden, die die Unternehmen und Betriebe kennen und deren langfristigen Erfolg im Auge haben, sollten auch bei strategischen Fragen Verantwortung übernehmen und mitbestimmen können. Was bevorsteht ist nichts anderes als das, was im 19. Jahrhundert mit der politischen Macht passiert ist. Damals wurde das Privateigentum der politischen Macht in den Händen von Königen und Aristokraten demokratisiert. Das 21. Jahrhundert muss das Jahrhundert der Demokratisierung der wirtschaftlichen Macht sein. Das ist weder linksextrem, noch revolutionär. Sondern die einzige richtige und pragmatische Antwort auf den Zustand unserer Gesellschaft.