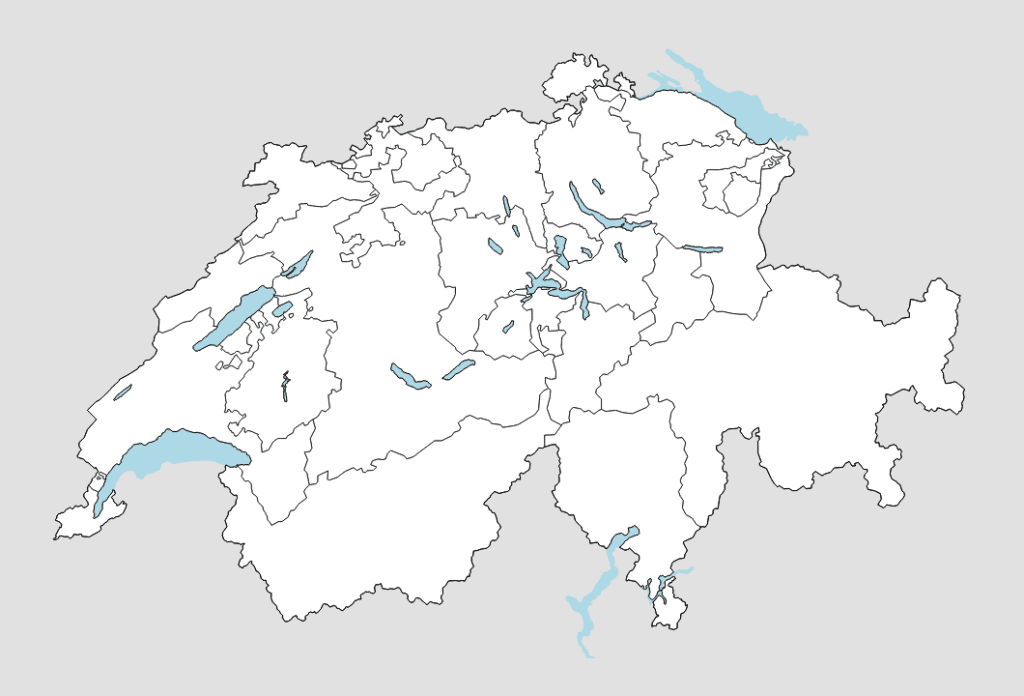Dienstag, 23. Oktober, 11 Uhr: unterwegs zum Meeting der Demokraten
Am Samstag, am Tag nach der letzten Debatte, verkündete das Team von Obama, dass in Ohio ein Meeting stattfinden wird. Eine einmalige Gelegenheit, die demokratische Kampagne aus der Nähe zu beobachten. Wir besorgten uns Tickets, und wir sollten nicht enttäuscht werden.
Ein paar Überraschungen und Feststellungen zu einem äusserst professionellen Meeting:
- Der Ort des Meetings: Das einfachste wäre gewesen, es in einer der riesigen Hallen der Region zu organisieren. Weit gefehlt: Wir treffen uns auf einer Wiese an der Biegung eines Flusses! Das Ziel ist klar: Man will Nähe, Einfachheit vermitteln.
- Die Grösse des Meetings. Ziemlich bescheiden, schon fast ein Familientreffen. Etwas weniger als 10’000 Personen, in der Mehrzahl Schwarze. Ohne Eintrittsticket gibt es für das Publikum keinen Zutritt. Und die Demokraten sind offensichtlich bemüht, die Zuschauerzahl zu begrenzen.
- Die Sicherheitskontrollen. Es stand auf der Einladung: “Kontrollen wie am Flughafen”. Tatsächlich. Ergebnis: mehr als anderthalb Stunden Anstehen vor Zutritt aufs Gelände. Insgesamt vier Stunden Warten vor dem Eintreffen von Joe Biden und Barak Obama, ohne Möglichkeit, sich zu verpflegen oder zu trinken, nicht einmal Wasser. Ganz offensichtlich ist der demokratische Aktivist ausdauernd!
- Eine äusserst patriotische Stimmung. Man weiss es, aber es überrascht immer wieder. Das Meeting beginnt mit der Nationalhymne, anschliessend segnet der Pastor die Menge und die Kandidaten. Es entsteht ein Gefühl allgemeiner Inbrunst. O.k., der Pastor geizt nicht mit Segnungen. Im Geist der Ökumene segnet er gleich noch Romneys Kampagne. Die Menge schwenkt kleine Amerikanerflaggen.
- Eine bis ins kleinste Detail geregelte Show. Barak Obama richtet sich nicht an die Menge. Diese ist auf seiner Linken aufgereiht. Er schaut in die Richtung eines Heeres von Kameras, von denen ihn lediglich ein paar Hundert Leute trennen. Und während seiner Rede schaut er natürlich mehr in die Kameras als zu den Teilnehmern. Hinter ihm eine Tribüne mit einem Panel von Aktivisten. Die Menge ist grösstenteils schwarz. Das Panel grösstenteils weiss… die Gesetze des Marketings, nehme ich an. Dasselbe Marketing, dank dem die Organisatoren im Voraus aufgezeichneten Applaus und Kreischen vorgesehen haben, falls die Menge zu wenig Begeisterung zeigen sollte.
Bleibt die Ankunft und die Rede von Obama. Er ist ca. fünfzig Meter entfernt von da, wo ich stehe. Der Typ strahlt eine unheimliche Energie aus. Und offensichtlich ist er jetzt ganz gekippt, jetzt sucht er den Nahkampf mit Romney. Die Zeiten des “Yes we can” scheinen mir weit weg zu sein. Der Kern seiner Aussage: Romney ist unglaubwürdig. Er leidet an Romneysia, ändert täglich die Position, orientiert sich an der Windrichtung. Das stimmt. Es ist aber doch erstaunlich zu sehen, wie Obama so viel Zeit aufwendet, über seinen Gegner anstatt über seine Projekte zu sprechen. Mein Schweizer Kollege, Philippe Leuba, zeigt sich ganz schockiert. Ich denke eher, dass im Land der negativen Werbung, mit der uns das Fernsehen bombardiert, unaufhörliche persönliche Attacken eine effiziente Strategie sind. Bestimmt hat das Kampagnenteam diesen Angriffswinkel in den letzten Tagen mittels Umfragen getestet. Hoffentlich bekommen sie Recht!
Dienstag, 23. Oktober, 19 Uhr
Szenenwechsel. Nach der multiethnischen und warmherzigen Menschenmenge am Obama-Meeting gelangen wir etwa 20 Kilometer weiter zum Meeting der Tea Party, dieser ultra-individualistischen Bewegung am rechten Rand der Republikanischen Partei. Ihr Programm: Die Regierung schwächen, die Steuern drastisch senken, die Wirtschaft dem Markt überlassen.
Die Tea Party führte die Republikaner bei den Midterm-Wahlen 2010 zum überwältigenden Sieg. Es ist interessant zu sehen, wo sie jetzt stehen. Zuerst sind sie etwas nervös, als Frankophone an ihrem Meeting auftauchen. Ihr Leader wird es später zugeben: “Manche meiner Jungs sind etwas paranoid”. Danach wird es für Europäer – von rechts wie von links – etwas spacig. Diese Leute sind gegen Abtreibung (man hat es erwartet), gegen den Staat (das ist schon spektakulärer), gegen Ausgaben auf nationaler Ebene für Bildung und Forschung. Sie kämpfen öffentlich gegen erneuerbare Energien und für die Kohle.
Vor ein paar Jahren hatte ich Ron Paul getroffen, Senator von Texas und einer ihrer Leader. Er hatte mir lang und breit erklärt, warum er für den freien Markt ist, aber gegen die WTO, gegen die Freihandelsabkommen, auch gegen die UNO. Und offensichtlich hat sich die Doktrin nicht stark verändert. Für den freien Markt, aber ohne jegliche Regeln, auch nicht jene der Globalisierung. Spektakulär, aber aus europäischer Sicht unter den politischen UFO abzuhaken.
Angesichts der Positionen dieser Leute habe ich das Meeting erleichtert verlassen. Trotz eines äusserst prominenten Panels (zwei in Washington amtierende Senatoren, der Senatskandidat für Ohio, mehrere Abgeordnete des Repräsentantenhauses): weniger als zweihundert Personen. Der lokale Vertreter der Tea Party sagt es selbst. Die Leidenschaft von 2010 ist ein wenig abgekühlt. Heute ist die Tea Party vor allem eine Pressure-Group innerhalb der Republikanischen Partei. Und aus Sicht der Demokraten eher eine gute Sache: Sie führt zu einer Radikalisierung der Republikaner, die sie wohl Stimmen im Zentrum kosten wird.