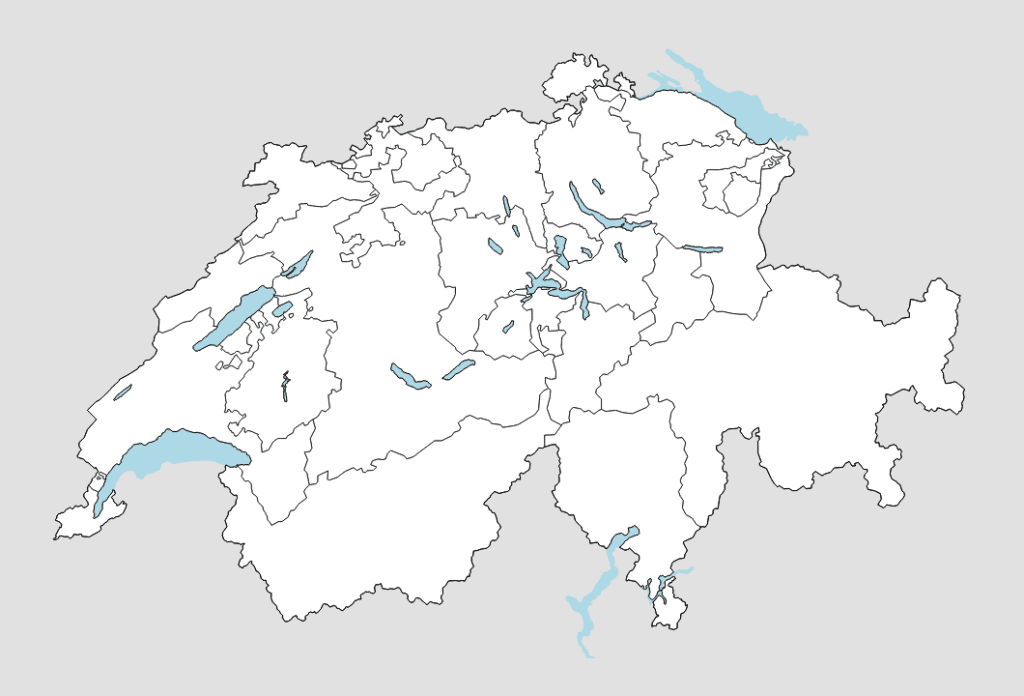Etwas mehr als ein Jahr ist es nun her, dass das Regime von Russlands Präsident Putin den Krieg in der Ukraine mit einer Grossoffensive ausgeweitet hat. Hiram Johnson, ein amerikanischer Senator, soll das Bonmot geprägt haben, dass das Erste, was im Krieg sterbe, die Wahrheit sei. Es ist schwierig, ein Jahr nach der Ausweitung des Krieges noch durchzublicken, wer jetzt wo genau steht und welche Interpretation richtig ist und welche falsch. Der nachfolgende Text ist der Versuch, etwas Ordnung ins Chaos zu bringen. Für mich als Linker und Sozialdemokrat sind zwei Fragen entscheidend: Erstens, was sagen die Direktbetroffenen, und zweitens, welchen «Charakter» hat der Krieg?
Von Cédric Wermuth, SP-Nationalrat (AG) und Co-Präsident der SP Schweiz
Für Linke ist die Sicht der Direktbetroffenen zwar nicht die einzige, aber doch immerhin der erste Hinweis auf eine Position. Diese Idee steckt im Kern der Idee der Selbstbestimmung, die für mich immer noch das Linkssein ausmacht. Bezogen auf den Krieg in der Ukraine ist die Frage schnell beantwortet. Es gibt gerade unter der ukrainischen Linken keine relevante Stimme, die etwas anderes vertritt als die absolute Priorität der militärischen Verteidigung – und zwar durchs Band von anarchistischen bis hin zu sozialdemokratischen Gruppen. Ich habe weder in direktem Kontakt, beim Besuch in der Ukraine noch sonst wo irgendwelche Stimmen gehört, die ernsthaft einen Frieden mit Gebietsgewinnen der Russen akzeptieren wollen, spätestens nicht mehr nach den Massakern von Butscha. Stellvertretend sei hier auf den Brief «An die westliche Linke» des Aktivisten Tara Bilous verwiesen, der in der linken Bewegung Sotsialny Rukh («soziale Bewegung», hier auf Twitter) aktiv ist und seit Beginn der Invasion in der ukrainischen Armee dient.
Ehrlicherweise muss man eingestehen, dass sich hier auch eine historische Schuld der westeuropäischen Linken gegenüber Osteuropa versteckt. Wir haben jahrelang nicht zugehört, wenn vor Putin gewarnt wurde, gerade im Fall der Ukraine. Nicht in böser Absicht, aber in einem naiven Glauben an die Notwendigkeit einer globalen Balance unter Einbezug Russlands (mehr dazu im nächsten Abschnitt). Dieser Blick war, man muss es so hart sagen, arrogant, ignorant, ja teilweise fast kolonialistisch. Und ja, genau diesen Blick haben gewisse Linke immer noch, wenn sie glauben, es besser zu wissen als die Ukrainerinnen und Ukrainer.
Kein falscher Antiimperialismus, kein falscher Frieden
Die zweite Frage ist etwas komplexer: Welchen «Charakter» hat dieser Krieg? Natürlich überlagern sich in diesem Krieg wie in jedem mehrere Konflikte und Interessen. Der französische Philosoph Etienne Balibar – auf den wir weiter unten zurückkommen werden – dröselt das schön auf (ich lasse hier die Details der Übersicht halber weg). Sicher, die Amerikaner:innen handeln auch hier nicht aus reiner Menschlichkeit. Auch sie haben ihre Interessen in Osteuropa und natürlich geht es auch um geostrategischen Einfluss. Das verleitet (und hat schon in der Vergangenheit) gewisse linke Kreise dazu, die russische Position zumindest teilweise zu verteidigen (und rechte sowieso). Das Argument lautet, dass wir als Linke den schrumpfenden Einfluss der imperialistischen USA als unipolare Weltmacht zu Gunsten einer multipolaren Welt begrüssen sollten. Die Hälfte davon ist zwar richtig, die andere Hälfte allerdings dramatisch falsch. Natürlich wäre eine Demokratisierung der Weltpolitik zu begrüssen, allerdings nicht unter den aktuellen Vorzeichen. Wenn der Preis für die Multipolarität das Erstarken des Einflusses autoritärer oder sogar faschistischer Regimes in Russland, China oder Indien ist, dann kann das keine Perspektive für die Linke sein. Wie die indische Kommunistin Kavita Krishnan richtig ausführt:
«Indem die Linke ihre Reaktion auf politische Konfrontationen innerhalb oder zwischen Nationalstaaten als eine Nullsummen-Option zwischen der Befürwortung von Multipolarität oder Unipolarität darstellt, hält sie eine Fiktion aufrecht, die selbst in ihren besten Zeiten immer irreführend und ungenau war. Aber diese Fiktion ist heute geradezu gefährlich, denn sie dient einzig als Erzählung und dramatisches Mittel, um Faschist:innen und Autoritäre in ein schmeichelhaftes Licht zu setzen.»
Putin kaschiert seine eigenen, offensichtlich ebenfalls imperialistischen Ansprüche hinter einer vermeintlich linken, vermeintlich antiimperialen Rhetorik gegen die «westliche Dominanz». Der Versuch besteht darin, die universellen Menschenrechte als westlichen Kolonialismus abzutun, was auf die Forderung nach einer wertfreien Multipolarität hinausläuft. Im Falle Russlands entspricht das konkret der Freiheit, im Namen des Antiimperialismus gegen die USA «faschistisch sein zu dürfen» (Krishnan). Oder wie es diese Gruppe russischer Exil-Linker formuliert:
When Putin speaks about getting rid of American hegemony in the world and even about “anti-colonialism” (!), he is not referring to the creation of a more egalitarian world order.
Putin’s “multipolar world” is a world where democracy and human rights are no longer considered universal values, and so-called “great powers” have free rein in their respective geopolitical spheres of influence.
This essentially means restoring the system of international relations that existed in the runup to World Wars I and II.
This “brave old world” would be a wonderful place for dictators, corrupt officials, and the far right. But it would be hell for workers, ethnic minorities, women, LGBT people, small nations, and all liberation movements.
A victory for Putin in Ukraine would not restore the pre-war status quo, it would set a deadly precedent giving “great powers” the right to wars of aggression and nuclear brinkmanship. It would be a prologue to new military and political catastrophes.
Es kann also nur schon angesichts der Bedrohung der grundlegenden Rechte der Arbeiter:innen, Frauen, ethnischen Minderheiten und LGBTQIA-Menschen keine sterile, wertfreie Multipolarität geben. Putins Projekt ist nicht primär anti-US-imperialistisch, sondern reaktionär und demokratiefeindlich. Die Frage, ob Russland unter Putin gemessen an historischen Kriterien präzise als «faschistisch» bezeichnet werden kann, untersucht Claus Leggewie. Leggewie sieht vier charakteristische Merkmale des Faschismus: Den Führerkult (mit starker Unterstützung aus der Bevölkerung), eine politische Theologie, den männlichen Chauvinismus und ein ideologisches Fundament aus Ultranationalismus und Imperialismus. Er kommt gerade im Vergleich mit den illiberalen Entwicklungen in anderen Ländern Osteuropas zu folgendem Schluss (den ich teile):
«Das alles verbietet eine Einordnung des Putin-Regimes als ‘Autokratie’, als ‘Illiberalismus’ und dergleichen, die ebenso auf Ungarn oder Mali zuträfe und einer Verharmlosung gleichkäme. Das Putin-Regime ist noch nicht bei den vollendeten Diktaturen [Adolf] Hitlers und [Josef] Stalins angekommen, aber faschistoide Züge sind bei ihm ebenso erkennbar wie Anschlüsse an das sowjetische (wie gesagt: nicht kommunistische) Erbe, die auch nicht im strengen Sinne stalinistisch sind, aber mit dem tiefen Zugriff der Sicherheitsapparate und Geheimdienste, in der völligen Zersetzung jedweder Opposition und auch mit der Indienstnahme von Kultur und Wissenschaft stark an den Stalinismus erinnern. Starren Typologien entgehen solche Resonanzen, während man in der im Kulturvergleich üblichen, eher granularen und graduellen Betrachtungsweise Tendenzen einer totalitären Herrschaft neuen Typs erkennt, die beide Varianten des 20. Jahrhunderts aufgenommen hat – der ‘stalinoide’ Kern ist von einer faschistoiden Schale ummantelt.»
Die Klammerbemerkung von Leggewie ist übrigens wichtig, auch in Abgrenzung zu billigen Versuchen bürgerlicher Kommentator:innen, Putin quasi in das ideologische Erbe der Linken einzuordnen. Wenn sich Putin auf die Sowjetunion bezieht, meint er dabei nie den Sozialismus als Ideologie, sondern grenzt gerade das Erbe Stalins davon ab:
«Während sich Putin als ‘Antifaschist’ in einem Kampf gegen den weltweiten und ukrainischen Nazismus wähnt, nimmt er weit positiver Bezug auf Stalin, wohlgemerkt nicht den Kommunisten und ewigen Generalsekretär der KPdSU, sondern den Feldherrn und imperialen Eroberer, den Putin wiederum in die Tradition des imperialen Zarenreiches stellt.»
Zur Ideologie und Rhetorik der Gewalt passt bei Putin leider auch die Praxis. Es ist richtig, es gibt Vorwürfe an beide Seiten bezüglich der Verletzung der Genfer Konventionen. Mir ist kein Krieg bekannt, in dem das nicht passiert, leider. Diese Vorwürfe müssen bei aller klar verteilten Sympathie auf beiden Seiten ernst genommen werden. Das Kriegsvölkerrecht gilt für alle. Aber die russische Seite setzt auf eine Strategie des Terrors gegen die Zivilbevölkerung. Einerseits, wenn sie systematisch öffentliche, zivile Infrastrukturen bombardiert und so versucht, den Widerstand zu brechen. Andererseits, wenn wir sehen, was die russischen Besatzer anrichten, wenn sie ein Gebiet besetzen und unter anderem systematisch sexuelle Gewalt anwenden. Als brutalstes Mahnmal dafür kann wohl Butscha herhalten. Gerade deshalb warnen Ukrainerinnen und Ukrainer wohl zu Recht vor einem Missverständnis, wenn Putin von «Frieden» spricht. Frieden unter russischer Besatzung bedeutet für die dort lebende Zivilbevölkerung kaum Frieden im eigentlichen Sinn, sondern Unterdrückung. Das zumindest lässt die Praxis der letzten Monate dringend vermuten.
Nationalismus = Nationalismus?
Ein weiteres Unbehagen vieler betrifft den Eindruck, zwischen zwei Nationalismen entscheiden zu müssen, dem russischen und dem ukrainischen. Die Frage ist, vereinfacht gesagt, ob es einen Unterschied macht, wo welche Grenze eines Nationalstaates durchläuft, da wir als Linke ganz grundsätzlich nicht die grössten Verfechter nationaler Grenzen sind. Wiederum gilt das gleiche wie oben: Auf dem Papier mag das stimmen, im konkreten Fall ist die Frage allerdings zynisch. Aber lassen wir jemanden dazu sprechen, der sich intensiv mit dieser Frage beschäftigt hat, gerade im Kontext der Ukraine und Russland: Wladimir Iljitsch Lenin. Putin hasst Lenin, weil er ihm die Schuld für die Trennung zwischen der Ukraine und Russland zuschreibt. Grund genug, ihn genau zu dieser Frage zu zitieren. Lenin schreibt 1922 zur Frage der Nationalitäten und zum Verhältnis der russischen Mehrheit zu den nationalen Minderheiten in der damaligen Sowjetunion:
«Es [geht] nicht [an], abstrakt die Frage des Nationalismus im Allgemeinen zu stellen. Man muss unterscheiden zwischen dem Nationalismus einer unterdrückenden Nation und dem Nationalismus einer unterdrückten Nation, zwischen dem Nationalismus einer grossen Nation und dem Nationalismus einer kleinen Nation […] Was ist für den Proletarier wichtig? Für den Proletarier ist nicht nur wichtig, sondern geradezu lebensnotwendig, sich seitens des Nichtrussen ein Maximum von Vertrauen im proletarischen Klassenkampf zu sichern. Was ist dazu nötig? Dazu ist nicht nur die formale Gleichheit nötig. Dazu ist nötig, durch sein Verhalten oder durch seine Zugeständnisse gegenüber dem Nichtrussen so oder anders das Misstrauen, den Argwohn zu beseitigen, jene Kränkungen aufzuwiegen, die ihm in der geschichtlichen Vergangenheit von der Regierung der ‘Grossmacht’nation zugefügt worden sind […] weil nichts die Entwicklung und Festigung der proletarischen Klassensolidarität so sehr hemmt wie die nationale Ungerechtigkeit und weil die ‘gekränkten’ nationalen Minderheiten für nichts ein so feines Gefühl haben wie für die Gleichheit und für die Verletzung dieser Gleichheit, sei es auch nur aus Fahrlässigkeit, sei es auch nur im Scherz, für die Verletzung dieser Gleichheit durch ihre Genossen Proletarier. Deshalb ist in diesem Falle ein Zuviel an Entgegenkommen und Nachgiebigkeit gegenüber den nationalen Minderheiten besser als ein Zuwenig. Deshalb erfordert in diesem Falle das grundlegende Interesse der proletarischen Solidarität und folglich auch des proletarischen Klassenkampfes, dass wir uns zur nationalen Frage niemals formal verhalten, sondern stets den obligatorischen Unterschied im Verhalten des Proletariers einer unterdrückten (oder kleinen) Nation zur unterdrückenden (oder großen) Nation berücksichtigen.»
Natürlich ist Lenin eine historische Figur, die ihre Überlegungen in einer ganz bestimmten Zeit entwickelt. Vieles von dem, für was er stand und tat, lässt sich mit dem Wissen von heute kaum mehr verteidigen, gerade in Bezug auf das Vorgehen der Sowjetunion in der Ukraine. Aber der – wie mir scheint – nach wie vor aktuelle Kerngedanke in diesem Zitat lautet: Das, was wir als Nationalismus einer unterdrückten Nation erfahren, ist meist die Forderung nach dem Recht auf Selbstbestimmung und Gleichheit mit anderen Nationen. Der Gedanke an nationalen Zusammenhalt bildet dabei die Klammer, um unterschiedliche Fraktionen der Gesellschaft trotz unterschiedlicher Interessen (z.B. Unternehmer und ihre Angestellten) zusammen auf ein Ziel einschwören zu können. Diese Form der Einforderung nationalen Selbstbestimmungsrechts ist eben nicht gleichzusetzen mit dem Nationalismus der unterdrückenden, imperialistischen Nation, oft begleitet von einer rassistischen Überlegenheitsideologie. Lenin entwickelt aus diesem Gedanken seine Theorie zum Selbstbestimmungsrecht, die zur ideellen Grundlage vieler antikolonialer Widerstandskriege werden sollte. Natürlich bleibt dieses Zugeständnis, wie man aus dem Zitat ebenfalls lesen kann, nicht ohne Absicht. Nur der Weg über das Selbstbestimmungsrecht erlaubt es, so Lenin, die Arbeiter:innenklassen unterdrückter Revolutionen für die sozialistische Revolution zu gewinnen. Man braucht dieses Ziel nicht in seiner Radikalität zu teilen, um sich der Forderung nach Gleichheit der Nationen anzuschliessen. Zu ähnlichen Schlüssen kommt zum Beispiel der liberale Philosoph Emanuel Kant im «Ewigen Frieden». Die Gleichheit der Nationen bildet u.a. die Grundlage der UNO, festgehalten in Art. 2 Abs. 1 der UNO-Charta: «Die Organisation beruht auf dem Grundsatz der souveränen Gleichheit aller ihrer Mitglieder.» Übrigens weist Lenin auch bereits auf das Dilemma sich überlagernder Imperialismen hin, wenn man dann in diesen Worten die aktuelle Auseinandersetzung zwischen den USA und Russland fassen will:
«Die Tatsache, dass der Kampf gegen eine imperialistische Regierung für die nationale Freiheit unter bestimmten Bedingungen von einer andern ‘Grossmacht’ für ihre ebenfalls imperialistischen Ziele ausgenutzt werden kann, kann die Sozialdemokratie ebenso wenig bewegen, auf die Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts der Nationen zu verzichten, wie die mehrfachen Fälle der Ausnutzung der republikanischen Losungen durch die Bourgeoisie in ihrer politischen Betrügerei und Finanzräuberei zum Beispiel in romanischen Ländern die Sozialdemokratie auf ihren Republikanismus zu verzichten bewegen können.»
Lenin entwickelt seine Theorie in zweifacher Abgrenzung. Einerseits liefert er sich einen jahrelangen Streit mit Rosa Luxemburg und anderen innerhalb der sozialistischen Bewegung, andererseits natürlich mit den liberal-konservativen Weltmächten und ihren Führern. Letzteres zeichnet Rita Augestad Knudsen in ihrem Buch «The Fight over Freedom in 20th and 21st Century International Discourse» anhand der Auseinandersetzung zwischen dem ehemaligen US-Präsidenten Woodrow Wilson und Lenin nach. Wilson ist für Knudsen der Gründervater der liberal-konservativen Vorstellung vom Selbstbestimmungsrecht. Sie nennt die radikale Konzeption des Rechts auf Selbstbestimmung nach Lenin Freiheit als Gleichheit, jene von Wilson Freiheit als Frieden und Nicht-Intervention. Wenn Lenin mit Selbstbestimmung das Recht der Menschen auf Demokratie und soziale Rechte meint (die eben auch einmal gegen das Friedensgebot erkämpft werden dürfen), so meint Wilson – und mit ihm die folgende liberal-konservative Tradition – vor allem die Souveränität der jeweiligen Regierungen. Selbstbestimmung muss in dieser zweiten Tradition nicht unbedingt mit ausgebauten Rechten im Inneren einhergehen. Linke würden sagen, es sei keine Perspektive «von unten». Frieden meint dann keinen Zustand umfassender positiver Rechte für alle, sondern insbesondere ungehinderten, globalen Handel «von oben». Deshalb ist es eben gerade kein Widerspruch, wenn jetzt Rechtslibertäre in ganz Europa für den «Frieden» mit Russland auf die Strasse gehen. Ihr Frieden würde sich in der Wiederherstellung ungehinderter Warenflüsse erschöpfen. Die «unsichtbare Hand des Marktes» sorgt dann in dieser Idee langfristig für den Durchbruch bürgerlich-demokratischer Ideale (was getrost durch die Realität widerlegt gelten darf). Dieser Gedanke steckt auch hinter der Neutralitätskonzeption der Rechten hierzulande. Die Neutralität dient der Versicherung, dass keine innere Konstellation eines anderen Staates den Handel beeinträchtigt, z.B. so Dinge wie fehlende Menschenrechte – selbst wenn das auch die Neutralität gegenüber der «Freiheit, faschistisch zu sein» bedeutet. Das ist der Nationalismus der entwickelten Nationen, hierzulande vertreten primär von der SVP, der dazu dient, die Ausbeutung anderer Völker zu Gunsten eines national-egoistischen Wohlstandsmodells zu rechtfertigen.
Um nicht missverstanden zu werden: Die Unterscheidung zwischen Nationalismus als Einforderung von Selbstbestimmung und imperialen oder ökonomisch-egoistischem Nationalismus ist kein Blanko-Check für ersteren. Die Geschichte des europäischen 19. Jahrhunderts zeigt, gerade auch für die Schweiz, dass (bürgerlich-)demokratisches Nation-Building, also die Entstehung republikanischer Institutionen und demokratischer Staatlichkeit, eben immer auch über die Idee der Nation führt. Der Historiker Timothy Snyder hat die ukrainische Geschichte sehr ausführlich aufgearbeitet. Anders, als es uns die putinsche Propaganda weismachen will, gibt es eine lange Tradition republikanischer Kämpfe in der Ukraine (seine Vorlesungsreihe zur ukrainischen Geschichte ist auf YouTube frei verfügbar). Sicher, das Land war auch vor dem Krieg alles andere als eine perfekte Demokratie, viele Bereiche der Gesellschaft werden von oligarchischen Strukturen beherrscht. Aber es ist immerhin ein Staat, der spätestens seit dem Fall des Eisernen Vorhangs um seine demokratische Form ringt und dabei auch offensichtlich Fortschritte erzielt, nicht zuletzt seit den Maidan-Protesten. Trotzdem drohen nationale Bewegungen – in welcher Form auch immer – negativ umzuschlagen, wie wir das leidvoll auch in den westeuropäischen Demokratien immer wieder erleben. Das geschieht zum Beispiel dann, wenn jetzt undifferenzierte Russophobie verbreitet und die Aggression Putins auf eine vermeintlich immerwährende, aggressive Charaktereigenschaft «des Russen» zurückgeführt wird. Oder, wenn in der Ukraine Versuche unternommen werden, russischsprachigen Ukrainer:innen ihre Muttersprache zu verbieten, wenn der (ehemalige) ukrainische Botschafter in der Schweiz fordert russischen Dissidenten das Asylrecht zu verweigern, weil sie qua ihres Russen-Seins mitschuldig seien, oder der ukrainische Nazi-Kollaborateur Stepan Bandera unkritisch zum Vorbild des Widerstands stilisiert wird. All das ist entschieden abzulehnen und zu kritisieren.
Was heisst das alles für die Linke?
Ich meine, für die Linke bedeutet dies im doppelten Sinne das, was Etienne Balibar als Strategie der «unity of opposites», also der Gleichzeitigkeit der Gegensätze, bezeichnet, wobei Balibar nur den ersten Sinn anspricht. Dieser erste Gegensatz meint die Notwendigkeit, die Ukraine mit allen möglichen Mitteln in ihrer Verteidigung gegen den russischen Imperialismus zu unterstützen, also auch mit militärischen. Ein «naiver Gesinnungspazifismus» kann angesichts der Bedrohung keine Option sein, wie Albrecht von Lucke mit Verweis auf Willy Brandt in den Blättern für deutsche und internationale Politik, wie ich meine richtig argumentiert:
«Doch er wusste stets, dass der Gesinnungspazifismus als totaler Gewaltverzicht moralisch integer nur für das eigene Leben, aber nicht für das anderer gelten kann.»
Und gleichzeitig bereits an einer Nachkriegsordnung zu arbeiten, die sowohl eine globale Aufrüstungsspirale als eine weitere Zunahme der Dominanz der NATO gegenüber der UNO verhindert. Um nochmals Brandt zu zitieren, aus seiner Rede zum Friedensnobelpreis 1971:
«Ich bekenne mich nachdrücklich zu den universellen Prinzipien des allgemeinen Völkerrechts, so oft sie auch missachtet werden. Sie haben in den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen ihren verbindlichen Ausdruck gefunden: Souveränität – territoriale Integrität – Gewaltlosigkeit – Selbstbestimmungsrecht der Völker – Menschenrechte. Die Grundsätze sind unabdingbar, auch wenn es an ihrer Erfüllung so oft mangelt.»
Langfristig kann es eben nur eine Dominanz des Militärbündnisses und damit das Recht des Stärkeren geben oder die Vorherrschaft des Völkerrechts und seiner Institutionen. Genau diesen Gedanken nahm die SP Schweiz vor wenigen Tagen auf, als sie vorschlug, den Re-Export von ehemals Schweizer Munition aus anderen Ländern an die Ukraine zu erlauben, sofern eine Mehrheit der UN-Generalversammlung die Verletzung der UN-Charta durch Russland feststellt (was der Fall ist). Der Vorschlag erlaubt, weder mit Verweis auf eine vorgeschobene Neutralität passiv bleiben zu müssen, noch gezwungen zu sein, das Primat der völkerrechtlichen Weltordnung vor der militärischen Logik aufzugeben. Und hier kommt auch das logische Nein zu weitergehenden, direkten Waffenexporten aus der Schweiz ins Spiel. Diese wären innenpolitisch unter den gegenwärtigen Verhältnissen nur um den hohen Preis einer generellen Liberalisierung der Waffenexporte und Stärkung der Schweizer Rüstungsindustrie zu haben. Und hier hat die Rechte bereits klar gemacht, um was es ihr geht: Nicht um die Ukraine, sondern um die Möglichkeit, wieder und weiter in Staaten wie Saudi-Arabien und andere Diktaturen exportieren zu können. Das würde jeder menschenrechtsbasierten Politik zuwiderlaufen.
Folgt man dem Gedanken einer langfristig auf das Völkerrecht ausgerichteten Politik weiter, wird auch klar, dass die Frage des Re-Exports von Schweizer Munition nicht der entscheidende Faktor ist, mit dem die Schweiz der Ukraine beistehen kann. Viel wichtiger wäre es, dafür zu sorgen, der Finanzierung der Kriegsmaschinerie Putins und auch künftiger, autoritärer Regimes über die Schweiz Einhalt zu gebieten. Dies verlangt nicht nur eine rigorose Regulierung des Finanz- und Rohstoffhandelsplatzes, sondern auch einen konsequenten Ausstieg aus der fossilen Energie, durch deren Kontrolle und Verkauf sich das Regime Putins schlussendlich finanziert und Europa unter Druck setzt. Dass genau dies aber von der Verwaltung und den bürgerlichen Parteien blockiert wird, zeigt, wie scheinheilig deren verbale Unterstützung der Ukraine letztendlich eben oftmals ist.
Zweitens bedeutet es über Balibar hinaus auch eine «unity of opposites», was die Unterstützung der ukrainischen Linken angeht. Diese kämpft nämlich an zwei Orten gleichzeitig: Einmal militärisch mit der Regierung Wolodimir Zelenskys um nicht weniger als das Überleben oder zumindest Fortbestehen der Ukraine als Staat. Und ein zweites Mal gegen die Regierung Zelenskys um die Frage, wie dieser Staat ausgestaltet werden soll. Natürlich gibt es zwischen diesen beiden Kämpfen eine klare Hierarchie. Man kann keine Auseinandersetzung um einen Staat führen, den es nicht gibt. Aber auch diese Dimension der Auseinandersetzung um die Nachkriegsukraine hat bereits begonnen. Leider spielt die Regierung von Zelenksy eine zwiespältige Rolle, teilweise auf Druck westlicher Interessen, aber lange nicht nur. Die Journalistin Anna Jikhareva spricht von einer «Deregulierung im Schatten des Krieges»:
«Kürzungen, Sparmassnahmen und eine neoliberale Agenda statt sozialer Gerechtigkeit […] Arbeitsmarktreformen, die zuvor unter anderem am Protest der Gewerkschaften gescheitert waren, nach Kriegsbeginn aber wieder aus der Schublade geholt wurden. Von der Regierung als ‘Antikrisenmassnahmen’ für den gebeutelten Arbeitsmarkt verkauft, beschneiden sie in Wahrheit vor allem die Rechte der Beschäftigten. Nur wenige Wochen nach dem russischen Angriff verabschiedete das Parlament ein Gesetz, das unter anderem den Kündigungsschutz lockert und die maximale Arbeitszeit auf 60 Stunden pro Woche erhöht. Der grösste Angriff auf die Rechte der ukrainischen Beschäftigten aber erfolgte am 19. Juli: Zum einen wurden sogenannte Nullstundenverträge erlaubt – eine radikale Form von Arbeit auf Abruf, bei der kein Anspruch auf eine Mindestarbeitszeit besteht und nur real erbrachte Leistungen vergütet werden. Zum anderen verabschiedete das Parlament ein Gesetz zur ‘Vereinfachung der Arbeitsbeziehungen in kleinen und mittleren Unternehmen’, was rund 70 Prozent aller Angestellten betrifft. Sie werden künftig nicht mehr von den noch aus der Sowjetzeit stammenden nationalen Arbeitsgesetzen geschützt. Statt Kollektivverträgen sollen die Beschäftigten fortan individuelle Verträge mit ihren Arbeitgeber:innen abschliessen, in denen dann jeweils auch Arbeitsbedingungen und Löhne definiert werden können.»
Der WoZ sagt der ukrainische Energieminister im Rahmen eines Gesprächs am Rande der Wiederaufbaukonferenz in Lugano, an die die Gewerkschaften nicht einmal eingeladen waren: «Das Gute ist», so der Minister zum Schluss, «dass wir als Regierung während des Krieges gesetzlich mehr Macht haben. Die Investoren können mir also einfach sagen, was sie brauchen.» Die Regierung benutzt das Kriegsrecht, um Deregulierungen des Arbeitsrechtes und Privatisierungspläne durchzusetzen, die sie vor dem Krieg nicht durchbrachte. Diese Angriffe gegen die Gewerkschaften gehen so weit, dass inzwischen sogar die Internationale Arbeitsorganisation der UNO und Stellen bei der Europäischen Union besorgt reagieren. Die Strategie, neoliberale Reformen in Krisensituationen durchzusetzen, hat die Globalisierungskritikerin Naomi Klein als «Schock-Strategie» beschrieben. Der eingangs erwähnte Taras Bilous ordnet die aktuelle Regierung unter Zelensky wie folgt ein:
«Es ist unwahrscheinlich, dass die neoliberale Hegemonie nach dem Krieg verschwinden wird. Auch ohne westliche Forderungen verfolgen die ukrainischen Behörden weiterhin eine unsoziale Politik […] Das bedeutet aber nicht, dass Zelensky einfach nur ein Vollstrecker der Interessen von Oligarchen oder westlichem Kapital ist. Während seiner Amtszeit kooperierte Zelensky manchmal mit den Oligarchen und geriet manchmal mit ihnen aneinander, aber er versuchte stets, ihren politischen Einfluss zu begrenzen. Und nun nutzte er den Krieg und erzielte dabei beachtliche Erfolge […] Im Allgemeinen war dies eine Politik im Interesse der sozialen Klasse, der Zelensky selbst angehört – der ‘mittleren’ Bourgeoisie. Reiche Kapitalisten, aber kleiner als die Oligarchen. Sie sind daran interessiert, den politischen Einfluss der Oligarchen einzuschränken, aber gleichzeitig sind sie mehr als die Oligarchen daran interessiert, die Rechte der Arbeiter einzuschränken […] Wir müssen die Verringerung des Einflusses der Oligarchen ausnutzen und gleichzeitig verhindern, dass Zelensky ein autoritäres Regime errichtet und den Angriff auf die Arbeiterklasse abwehren […] Juschtschenkos Team war ärmer als die Oligarchen, aber sie waren ziemlich reiche Kapitalisten. Das Team von Zelensky ist noch ärmer als sie […].»
Die Linke in Westeuropa und anderswo muss eben auch hier zwei, respektive sogar drei Dinge gleichzeitig tun: Die Unterstützung der Regierung Zelenskys im Kampf gegen den russischen Imperialismus mittragen, die Emanzipation der Ukraine von den «eigenen» Oligarchen vorantreiben helfen und gleichzeitig Gewerkschaften, Zivilgesellschaft und linke Parteien im Widerstand gegen die neoliberalen Pläne unterstützen. Eine der wichtigsten Forderungen ist dabei der Schuldenerlass für die Ukraine. Praktisch genau vor 70 Jahren trat das Londoner Schuldenabkommen in Kraft. Deutschlands Kriegsfolgeschulden wurden um die Hälfte gekürzt. Erst das erlaubte es dem Land, seine Wirtschaft wiederaufzubauen. Die Ukraine wird ebenfalls einen Schuldenerlass brauchen, das steht ausser Frage. Sonst droht die Schuldenlast, das Land selbst bei einem erfolgreichen Ausgang der militärischen Auseinandersetzung über Jahrzehnte zu erdrücken. Und was das für die neoliberalen Pläne bedeutet, lässt sich leicht erahnen.
Hier schliesst sich, drittens, der Kreis zur Frage der Verantwortung «des Westens» oder der NATO für den gegenwärtigen Krieg. Auch diese darf die Linke nicht tabuisieren. Es steht ausser Frage, der aktuelle Krieg in der Ukraine ist Folge des putinschen Imperialismus. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Aber natürlich gibt es eine Vorgeschichte, eine Eskalationsspirale. Wie praktisch immer in Kriegen. Heute ist zum Beispiel unbestritten, dass die Versailler Verträge nach 1918 ein Fehler waren, weil sie Deutschland die alleinige Kriegsschuld übertrugen und mithalfen, den Boden für Ressentiments zu schaffen, die die Nazis anschliessend ausnutzten. Niemand würde allerdings deswegen den Nationalsozialismus als solchen entschuldigen wollen. Analoges finden wir heute vor mit einer Eskalationsgeschichte, die mindestens bis zum Fall der Sowjetunion zurückreicht. Es ist kaum ernsthaft in Abrede zu stellen, dass die NATO danach die Rolle der UNO und auch der OSZE zunehmend in Frage zu stellen begann und NATO-Staaten Verantwortung tragen für aggressive, militärische Einsätze mit der Folge der Diskreditierung der globalen Sicherheitsarchitektur – als Stichworte reichen Irak und Afghanistan. Und bei allen geostrategischen Debatten über Fehlentscheide und gegenseitige Provokationen, die man führen kann, scheint mir ein zentrales Versagen darin zu liegen, überhaupt erst die Entstehung von Voraussetzungen toleriert resp. eben sogar befördert zu haben, die den Aufstieg des mafiösen Komplexes zwischen Putin und der russischen Oligarchie mindestens erleichterten. Dazu gehört erstens der turbokapitalistische Umbau der ehemaligen Sowjetunion mit der dramatischen Abstiegserfahrung von Millionen von Menschen. Und zweitens die selbstverschuldete Abhängigkeit von fossiler, russischer Energie. Naiv hat Europa seine Strom- und Energieversorgung dem Markt überlassen. Der «unsichtbaren Hand». Das hat es Putin einfach gemacht, die Politik hinter den Gas- und Öllieferungen verschwinden zu lassen. Diese Abhängigkeit Europas war einer der offensichtlichen Gründe, weshalb man Putin nicht früher Einhalt geboten hat, obwohl er eine «rote Linie» nach der anderen überschritt.