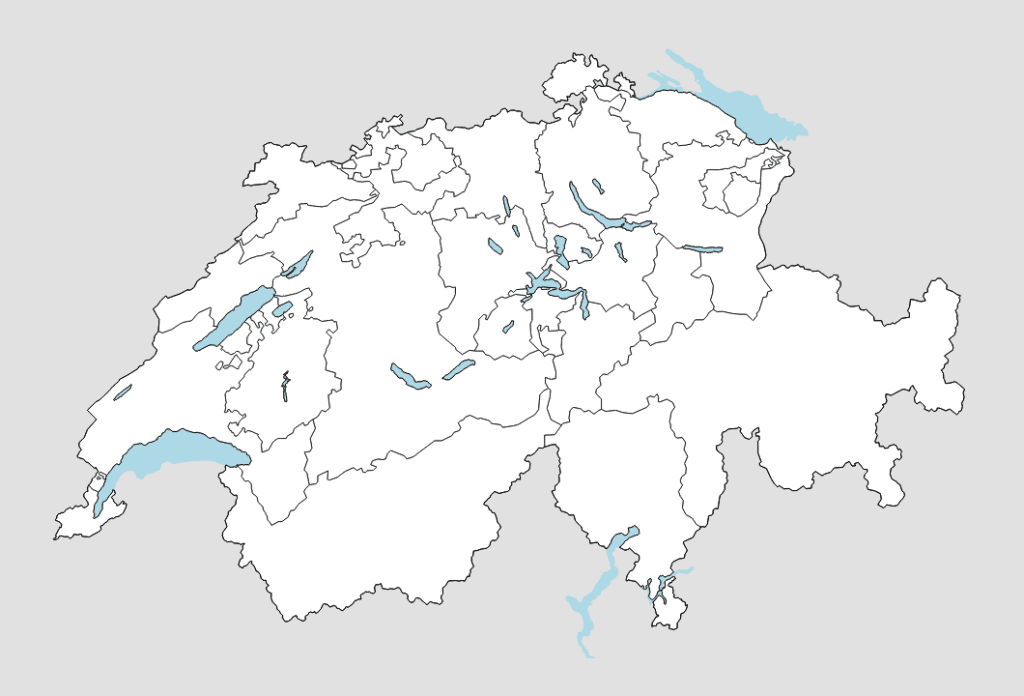Ich persönlich habe die Strategie der Akzeptanz gewählt. Das bedeutet: Sich so zu verhalten, als wäre man ein Mann, wie die anderen auch. Weiblichkeit kaschieren. Sitzungszeiten akzeptieren, die absolut unvereinbar sind mit einem Familienalltag und kleinen Kindern. So tun, als wäre das alles kein Problem. So tun, als wäre Politik nicht geprägt von Paternalismus, Respektlosigkeit und Vulgarität. So tun, als wäre man nicht die einzige Frau in der Sitzung. Sich aufplustern. Mit lauter Stimme sprechen. Kurz: Lächeln und Zähne zusammenbeissen. Und weitermachen in der Hoffnung, dass sich die Welt mit der Zeit verändert – dass man sie selbst verändern kann.
Seit diesem Jahr scheint diese Methode, die auch viele andere Frauen gewählt haben, plötzlich aus der Mode gekommen zu sein. Diese Methode, die die Frauen ihrem Schicksal trotzen liess, diese Strategie des Ausweichens, des Akzeptierens – all das hat nun ein Ende. Der Wind dreht sich und eine Welle kommt auf allen Kontinenten, an allen Fronten ins Rollen. Sie verlangt, dass die Frauen für sich selber leben, ohne einen Teil ihrer Identität ändern zu müssen. Der Gleichstellungsappell von Künstlerinnen auf dem roten Teppich in Cannes, die wachsende Präsenz der Schweizer Bäuerinnen in der Agrarpolitik, der Kampf der Iranerinnen gegen das Kopftuch, für den sie ihre Freiheit opfern, die grünen Tücher, die Argentinierinnen tragen und gegen Gewalt protestieren, die streikenden Isländerinnen und die kurdischen Kämpferinnen in Syrien… Es liegt etwas Einzigartiges, etwas Bewegendes und Umfassendes im heutigen Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter.
Vielleicht zum ersten Mal wirken die diversen feministischen Kämpfe zusammen: In die „klassischen“ gewerkschaftlichen und politischen Interventionen reihen sich gleichzeitig Forderungen nach dem Respekt gegenüber dem Körper und der physischen Integrität. Als wären 1918 und 1968 eins. Als würde Christiane Brunner zusammen mit Beyoncé demonstrieren. In der Schweiz und andernorts schauen sich die Frauen um und werden sich bewusst, dass die Welt nicht für sie gemacht ist, dass sie viel eher (fast) ohne sie gemacht ist. Und so wird die Liste der Forderungen immer länger: Lohngleichheit, Anerkennung von Care Arbeit, Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Aber das ist nicht alles. Frauen wollen auch gefahrlos in den Städten spazieren gehen können. Sie wollen Alkohol trinken, ohne Angst davor zu haben, angefeindet zu werden. Sie wollen, dass es Licht gibt in den Parkhäusern. Sie wollen, dass sie in Ruhe stillen können. Oder auch nicht. Dass ihr Körper kein Versuchslabor ist. Dass alle – ob Schweizerinnen oder Ausländerinnen – Schutz finden vor Ausbeutung, Missbrauch, Vergewaltigung. Dass am Arbeitsplatz keine sexuelle Belästigung, keine demütigenden Witze, keine sexistischen Angebote, keine deplatzierten Handlungen mehr toleriert werden. Dass die Strassen, die Brunnen, die Plätze ihre Namen tragen. Dass sie Zugang haben zu Stellen in der Forschung, zu Nobelpreisen, zur Musik- oder Theaterszene. Dass sie in der Schule Corina Bille lesen können und nicht immer nur Charles-Ferdinand Ramuz.
Am 29. Mai nimmt sich der Ständerat erneut der Revision des Gleichstellungsgesetzes an. Der Entwurf, der von der Mehrheit des Rats an die Kommission zurückgewiesen worden ist, kommt in nahezu identischer Form wieder und folgt damit einer Gesetzmässigkeit, die die Frauen aus dem Haushalt natürlich schon sehr gut kennen: Staub verschwindet nicht, wenn man ihn unter den Teppich kehrt. Dieser Schritt muss also getan werden. Unbedingt. Und mit Sicherheit wird er nicht der letzte gewesen sein.