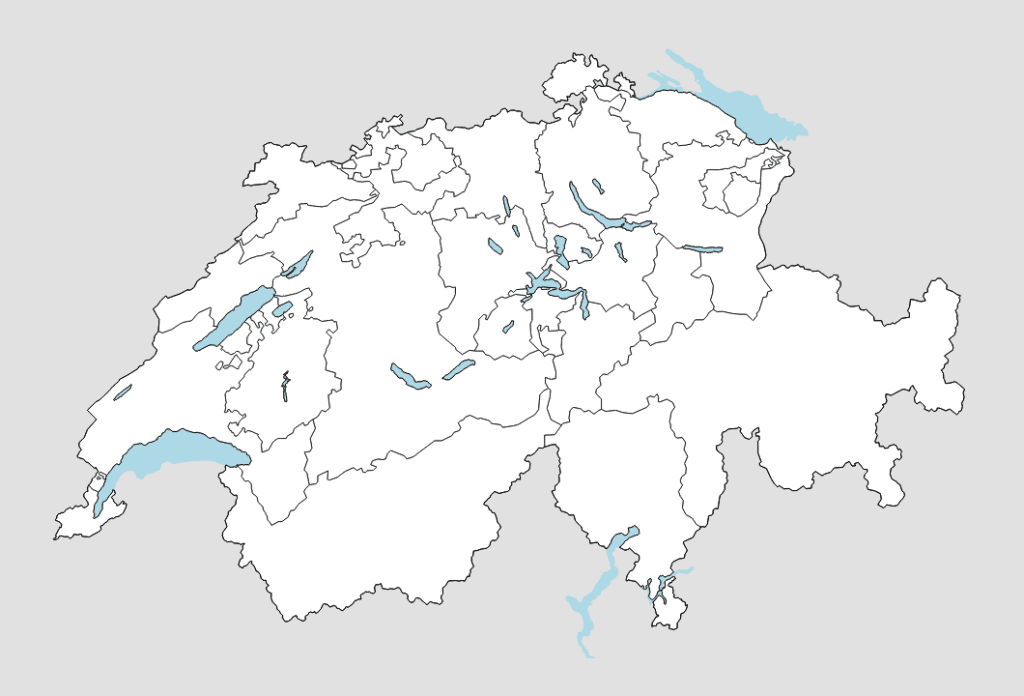Hört man bürgerlichen Politikerinnen und Politikern zu und den Krankenkassen, die hinter ihnen stehen, scheint klar: Schuld an der «Kostenexplosion» sind die Versicherten selber mit ihrer «Anspruchshaltung».
Tönt einleuchtend – aber ist die Sache so einfach? Schauen wir uns ein paar Fakten an:
- Mit dem Krankenversicherungsgesetz wollte man ab 1996 die Kosten dämpfen. Darum setzte man auf Tarifpartnerschaft und Konkurrenz unter den Krankenkassen. Gleichzeitig wurde aber auch die öffentliche Hand entlastet. Und da die staatlichen Subventionen für die Kassen wegfielen, sahen sich diese gezwungen, dafür die Prämien für die Versicherten zu erhöhen. Das wiederum sollte durch das System der individuellen Prämienverbilligungen wettgemacht werden. Doch die Rechnung ging nicht auf: die Prämienkosten haben sich seit der KVG-Einführung mehr als verdoppelt, die Belastung der Haushalte ist enorm gestiegen, gerade für Familien und den Mittelstand. Und die Prämienverbilligungen sind inzwischen zum Spielball der Politik geworden.
- 2012 wurde die neue Spitalfinanzierung eingeführt – auch hier sollte es der Markt richten. Die Vergleichbarkeit der Fallkosten sollte den Wettbewerb unter den Spitälern anheizen und so die Kosten senken. Das Gegenteil ist passiert. Die Hospitalisierungskosten sind gestiegen, weil das System zu unnötigen medizinischen Leistungen verleitet. Die Spitäler buhlen um möglichst lukrative Patientinnen und Patienten. Es läuft ein teures Wettrüsten in technologischer und baulicher Hinsicht. Spital-CEOs animieren Chefärzte mit Boni, möglichst viele gewinnbringende Eingriffe vorzunehmen. Selbst die OECD kritisiert an unserem Gesundheitssystem die bestehenden «Anreize für möglichst viele Behandlungen» anstelle des Wettbewerbs um gute Behandlungsergebnisse. Das Sparpotenzial durch die Vermeidung unnötiger Eingriffe wird von Experten auf mehr als 3 Milliarden Franken geschätzt.
- Auch die Medikamentenkosten in der Schweiz sind mindestens 490 Millionen Franken pro Jahr zu hoch, wie der Krankenkassenverband Santésuisse erhoben hat. Nicht etwa, weil die Patientinnen und Patienten mehr Pillen schlucken würden als unsere Nachbarn, sondern weil erstens die Pharmabranche von einem Währungsprivileg von zurzeit Fr. 1.26 profitieren, weil zweitens Hersteller und Verteiler einen happigen Schweiz-Zuschlag verrechnen und weil das Sparpotenzial bei den Generika zu wenig genutzt wird. Auch bei den medizinischen Mitteln und Gegenständen (Verbandsmaterial, Hörgeräte etc.) könnte Jahr für Jahr ein Betrag von über 100 Millionen eingespart werden, wie Preisüberwacher und Santésuisse ausgerechnet haben. Allein diese beiden Posten machen ca. 2,5 Prämienprozente aus.
- Qualitätssicherung ist im Gesundheitswesen ganz zentral. So verursachen Infekte in Spitälern und Heimen jedes Jahr vermeidbares Leid bei Kranken und Angehörigen – und Kosten von mehr als 300 Millionen Franken. Swissnoso, die Vereinigung der Spitalinfektiologen, geht davon aus, dass mindestens ein Drittel davon absolut vermeidbar wäre. Trotzdem fehlt es an Programmen zur Infektionsprävention.
Diese Beispiele werfen Schlaglichter auf die wirklichen Ursachen der steigenden Kosten und Prämien. Das Verrückte an dieser Situation: vieles könnte das Parlament verbessern. Doch Änderungen im Sinne der Versicherten, der Patientinnen und Patienten scheitern oft an den starken Lobbys, die sich in der Gesundheitspolitik engagieren. Denn es geht um sehr viel Geld.
Eine am Wohl von uns allen orientierte Gesundheitspolitik darf zwei Dinge nicht aus den Augen verlieren: 1. Kostensenkung durch die Ausschaltung von preis- und mengentreibenden «Marktmechanismen». 2. Qualitätssicherung auf allen Ebenen des Angebotes.
Es gilt unser gutes Gesundheitswesen noch besser und bezahlbar für alle zu machen. Der Weg aber, auf dem wir uns jetzt befinden, führt weiter in eine Zweiklassenmedizin, in der die Anbieter das Sagen haben – und Versicherte und Patienten bezahlen müssen.