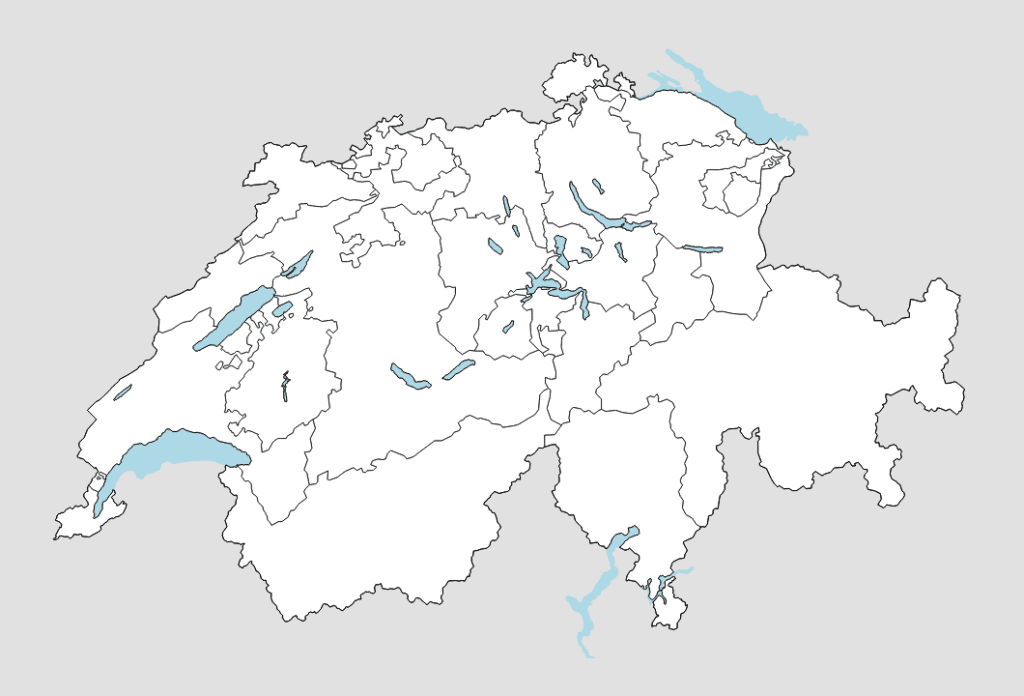Krisen gehören zum Kapitalismus wie das Amen in die Kirche. Bei der Erwirtschaftung von Mehrwert kommt es nicht selten zur Überproduktion, also zur Produktion von Waren und Dienstleistungen, die auf Grund des zu grossen Angebots irgendeinmal keinen realen Gegenwert mehr finden. Das Platzen dieser Preisblasen löst zuweilen grosse Krisen aus, die besonders die Lohnabhängigen hart treffen.
Die grosse Finanzkrise von 2008, ausgelöst durch das Platzen der US-amerikanischen Immobilienblase, war eine solche und bis heute haben die Volkswirtschaften dieser Welt mit ihr zu kämpfen. Mit Milliarden mussten zahlreiche Staaten die aufgrund der Krise in Schieflage geratenen Banken retten und verschuldeten sich damit nachhaltig. Die Folgen sind dramatisch: Armut, Arbeitslosigkeit und Sozialabbau beherrschen heute Südeuropa und dämpfen das Wachstum auch im Rest der EU.
Nur die Schweiz blieb bisher weitgehend verschont. Warum? Verantwortlich ist nicht zuletzt der Mindestkurs des Frankens zum Euro, den die Schweizerische Nationalbank zum Schutz des Werkplatzes Schweiz 2011, mitten in der Krise, eingeführt hatte. Dank der Schwächung des Frankens blieb die Schweizer Exportwirtschaft, die mit rund 40 Prozent an der Gesamtwirtschaft international sehr gross ist, wettbewerbsfähig.
Der Mindestkurs des Frankens gegenüber dem Euro habe zu Exportüberschüssen geführt, analysiert heute die «Wochenzeitung». Das ist richtig. Ohne den Mindestkurs hätte die Krise die Schweiz viel früher hart getroffen. Trotzdem war der Mindestkurs richtig. Denn eine Deindustrialisierung der Schweiz, wie sie uns seit dem Wegfall des Mindestkurses droht, hilft den Menschen in den europäischen Krisenländern auch nicht. Wer glaubt, dass «Strukturbereinigungen» und eine weitere Deregulierung, wie sie die Neoliberalen seit Jahren predigen, mehr Gleichheit und Wohlstand bringen, irrt gewaltig.
Solange die Welt und vor allem die Volkswirtschaften nationalstaatlich organisiert sind, stehen sie im Kapitalismus in einem erbitterten Wettbewerb zueinander. Der Verteilungskampf um den erarbeiteten Wohlstand erfolgt nicht nur zwischen Kapital und Arbeit, sondern auch zwischen den Ländern. Das ist das Problem. Der Schutz der arbeitenden Bevölkerung und die Verteidigung des sozialen Standards – sei es durch Verteilungs-, Konjunktur- oder Geldpolitik – ist hingegen ein legitimes und berechtigtes Anliegen der politischen Linken und der Gewerkschaften. Es ist sogar die einzige Möglichkeit, den Ausbeutungsdruck konkret zu mildern.
Die Franken-Krise legt vielmehr ein anderes Problem offen: Den Mangel an einer wirtschaftspolitischen internationalen Perspektive. Also die Beschränkung der Demokratie auf ein Land, unter Ausschluss der wirtschaftlichen Sphäre. Solange das Kapital unbeschränkt derart mobil zwischen den Ländern zirkulieren kann, solange die übermächtigen Banken privat und nur dem Profit verpflichtet sind, solange die Grossaktionäre und Manager allein über den unternehmerischen Umgang mit Krisen bestimmen und solange es keine gemeinsame, politische Steuerung gibt, wird es immer Gewinner und Verlierer der unterschiedlich entwickelten Volkswirtschaften geben. Was aber wäre, wenn Europa nicht nur eine gemeinsame Währungspolitik, sondern auch eine gemeinsame, demokratische Wirtschaftspolitik hätte? Die Rettungsübungen der EZB wären hinfällig und die Austeritätspolitik auch. Aber dafür braucht es politische Mehrheiten und es braucht die Schweiz – als Teil der EU.
Jetzt ist sie da, die Krise. Und vielleicht ist sie die Chance für die Schweiz, aus ihrem isolationistischen Dornröschenschlaf zu erwachen.