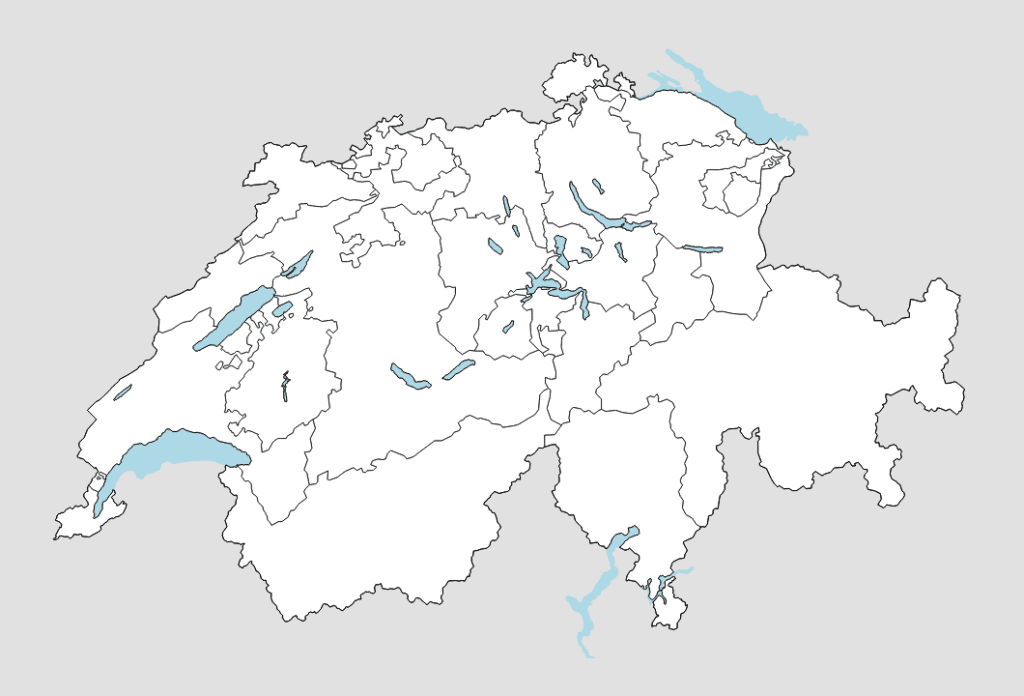Unter dem Titel «Der grosse Frust» kommentierte der «Tages-Anzeiger» Ende Oktober den zunehmenden Frust der Angestellten von Grossunternehmen angesichts fortschreitender Sparmassnahmen für die Belegschaft bei gleichzeitigen Goodies für die Teppichetagen. «Der Chef kassiert ein Millionengehalt, dem Schichtarbeiter wird der Gratisparkplatz gestrichen. Der Verwaltungsrat fliegt für eine Sitzung in corpore nach Singapur, den Mitarbeitern werden die Reisespesen gekürzt. Der Konzernleiter kassiert trotz Verlust einen Bonus, die Angestellten erhalten keine Vergünstigung mehr für Krippenplätze», so Wirtschaftsredaktor Andreas Möckli. Zu Recht stellt er fest, dass diese wachsende Ungleichheit direkte politische Auswirkungen hat: «Wer sich innerhalb eines Unternehmens nicht mehr wehren kann, oder zumindest diesen Eindruck gewinnt, der sucht nach einem anderen Ventil, etwa in der Politik». Als Beispiel wird die SVP-Zuwanderungsinitiative angeführt. Ein laut gesetztes Zeichen gegen die herrschende Ungerechtigkeit. Unzählige Beispiele wie Trump, der Brexit oder die zunehmende Polarisierung liessen sich anfügen. Nach dieser sehr treffenden Analyse verpasst es der «Tages-Anzeiger»-Autor aber leider, Lösungen vorzuschlagen. Stattdessen beschränkt er sich auf dieselben moralischen Appelle, die schon seit Jahren nichts nützen: «Die Manager sollten ihren Blick weg von ihrem eigenen Portemonnaie wieder stärker auf das Wohl ihrer Angestellten richten. Respekt und Wertschätzung sind Stichworte dazu».
Mit Respekt und Wertschätzung ist es leider nicht getan. Denn das beschriebene Problem des Frusts und der Ohnmacht in Unternehmen ist kein moralisches, sondern ein systemisches. Die Demokratie endet für die allermeisten Menschen abrupt am Arbeitsplatz. Während sich die Demokratie im Staatswesen in den meisten Ländern in den vergangenen hundert Jahren immer mehr durchsetzte und wir in der Schweiz inzwischen über wichtige Regeln unseres Zusammenlebens demokratisch entscheiden können – etwa darüber, wie unsere Schulen funktionieren sollen oder wie unser Rentensystem ausgestaltet ist –, hört die Mitbestimmung beim zentralsten Bereich unserer Gesellschaft auf: Der Art und Weise, wie gewirtschaftet wird.
Das ist an sich nichts Neues. Seit frühkapitalistischen Zeiten hat sich daran kaum etwas geändert. Aber durch die zunehmende Dominanz des Kapitals gegenüber der Arbeit und der rasant voranschreitenden Globalisierung der Finanzströme hat sich das Problem noch einmal verschärft. Während früher mit den Eigentümern einer Unternehmung geredet oder verhandelt werden konnte (wenn nötig auch mit Streik), ist das heute schwierig bis unmöglich geworden. Erstens wurden die Unternehmen grösser, damit mächtiger und weniger zugänglich für Kompromisse. Zweites sind wir durch die Globalisierung als Gesellschaften erpressbarer geworden. Höhere Löhne? Dann lagern wir halt nach Polen aus. Mehr Steuern? Dann ist unser Hauptsitz neu in Luxemburg. Und drittens, und das ist das Hauptproblem, hat sich auch die Eigentümerstruktur von Unternehmungen gewandelt. Heute sind die Eigentümer unzählige Aktionäre und Investmentfonds rund um den Globus. Einen Ansprechpartner gibt es nicht mehr. Den einzigen Anspruch, den diese Eigentümer haben, sind steigende Renditen. Und die Manager der Unternehmen befolgen diesen Auftrag. So gesehen ist der Ruf nach mehr «Respekt» und «Wertschätzung» bestenfalls naiv, im schlechtesten Fall verantwortungslos. Denn dass sich an diesen Zuständen etwas ändern muss, haben die letzten Jahre und Monate mehr als deutlich gemacht. Wirtschaftliche Stagnation, Ungleichheit und damit verbundene Perspektivlosigkeit und Abstiegsängste breiter Bevölkerungskreise bestimmen je länger je mehr die Politik – mit ungewissem Ausgang.
Wie gefährlich Frust und steigende ökonomische Ungleichheit für eine Gesellschaft sein können, beschrieb schon der griechische Staatsmann Solon im 6. Jahrhundert vor Christus. Die Vertreterinnen der neoklassischen Ökonomie haben es hingegen bis heute nicht begriffen. Heute entscheiden nur ein paar wenige darüber, wie die Wirtschaft funktioniert. Und genau darum funktioniert sie auch vor allem für ein paar wenige. Während die Profite für das reichste Prozent in der Schweiz steigen, wird die ökonomische, ökologische, soziale und politische Krise immer grösser. Es wäre naiv zu glauben, dass sich daran ohne Veränderung der Machtverhältnisse etwas ändert. Wer daran etwas ändern will, muss beim Problem, der Diktatur von ein paar wenigen, etwas ändern.
Mit ihrem Positionspapier Wirtschaftsdemokratie mit dem Titel «Eine Zukunft für alle statt für wenige – Eine demokratische, ökologische und solidarische Wirtschaft zum Durchbruch bringen», das Anfang Dezember am Parteitag diskutiert wird, schlägt die SP genau das vor: Mit mehr Demokratie sollen die ungleichen Machtverhältnisse in der Wirtschaft verändert und damit eine zukunftsfähigere und innovativere Ökonomie ermöglicht werden. Mitarbeitende sollen Mitbestimmungsrechte in den Unternehmungen erhalten und am Gewinn beteiligt werden. Der Service Public soll ausgebaut und Konsument_innen besser einbezogen werden. Der Boden soll als Gemeingut gesichert und demokratische Wirtschaftsformen gefördert werden. Mit diesen und weiteren Massnahmen könnte der Frust und die Ohnmacht vieler Menschen in schöpferische, produktive Energie zu Gunsten von uns allen verwandelt werden. Denn wer unzufrieden ist und eine Möglichkeit zur Mitbestimmung hat, nutzt diese in der Regel auch, um etwas ins Positive zu ändern statt willkürlich Frust abzulassen. Und wo die Interessen vieler vertreten sind, setzen sich diese auch eher durch. Oder wie es Abraham Lincoln in seiner Gettysburg-Rede formulierte: «A new birth of freedom through a government of the people, by the people, for the people». Es gibt keinen triftigen Grund, warum dieser für die Gründung der modernen Demokratien so zentrale Grundsatz in Zukunft nicht auch in der Wirtschaft gelten sollte.