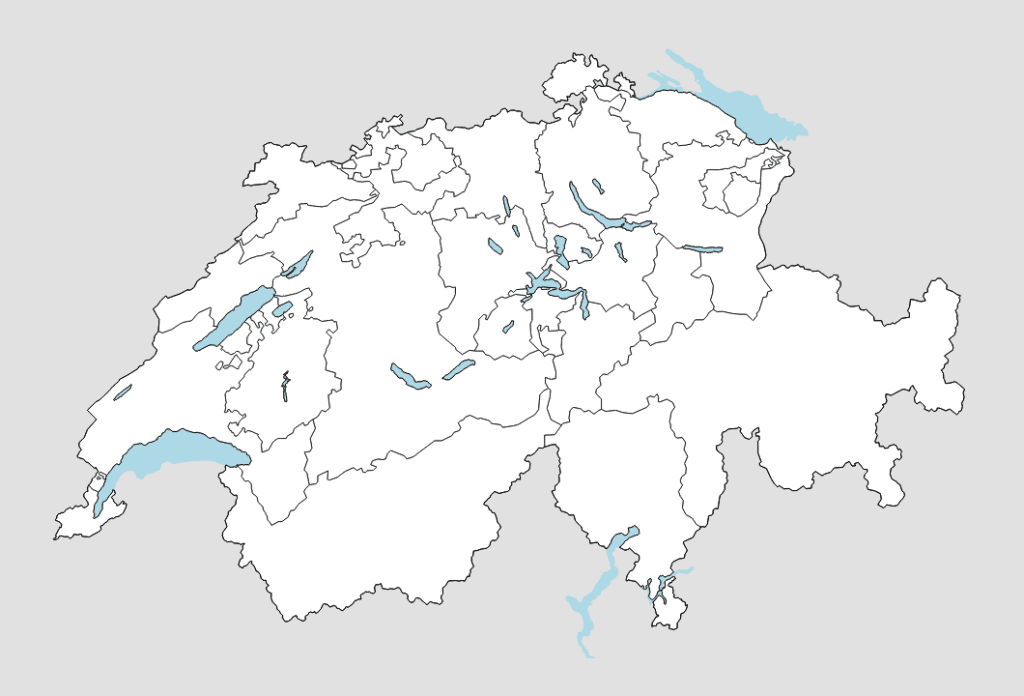Die Schweiz ist keine Insel der Glückseligkeit. Bedrohungen und Risiken bestehen durchaus, doch sind diese je länger, desto weniger militärischer Natur. Während die Schweiz von Freunden umgeben ist, soll der Gripen in einem grossen Krieg in Europa eine autonome Verteidigung unseres kleinen Landes sicherstellen. Ein solches Szenario ist derart unwahrscheinlich, dass es geradezu absurd ist, dafür Milliarden aufzuwenden.
Insgesamt wird die Gripen-Beschaffung über 10 Milliarden Franken kosten. Denn Kampfjets kosten nicht nur bei ihrer Beschaffung, sondern während der ganzen Lebensspanne. Die 3 Milliarden Franken, welche die Gripen-Befürworter immer wieder nennen, sind bloss die reinen Beschaffungskosten. Dazu kommen die Kosten für die künftigen Modernisierungen, für die Beschaffung von zusätzlicher Munition, Lenkwaffen und Bomben sowie den Unterhalt – das kostet nochmals etwa das Doppelte des eigentlichen Kaufpreises. Ausserdem müssen die Kosten für Immobilieninvestitionen über 105 Millionen Franken sowie die übergangsweise Anmietung von 11 Gripen für 245 Millionen Franken (ohne Betriebskosten) einberechnet werden. In Tat und Wahrheit entscheidet die Stimmbevölkerung also über die Ausgabe von mehr als 10 Milliarden Franken.
Das ist viel Geld, zu viel. Und es wird später anderswo fehlen: bei der Bildung, im öffentlichen Verkehr oder bei der Wohnbauförderung.
Da der Gripen E erst auf dem Papier existiert und noch fertig entwickelt werden muss, könnten die Kosten sogar noch deutlich höher ausfallen. Das erste Testflugzeug dieses Typs will die Herstellerfirma Saab erst 2015 fertigen. Bis dahin ist unklar, ob der Gripen die versprochene Leistung zum versprochenen Preis wird liefern können. Trotzdem bezahlt die Schweiz ungewöhnlich hohe 40 Prozent des Kaufpreises vorab. Da auch nach den Nachverhandlungen und stundenlangen Anhörungen in den Sicherheitspolitischen Kommissionen offenbleibt, was genau passiert, wenn die 22 Gripen E nicht rechtzeitig oder nicht im versprochenen Umfang geliefert werden oder wenn die Kosten aus dem Ruder laufen, tragen die Schweizer Steuerzahlerinnen und Steuerzahler das Risiko.
Hinzu kommt: Die Evaluation durch das VBS hat ergeben, dass der Gripen weniger leistungsfähig ist als die heutigen F/A-18. Saab hat Dutzende von technischen Nachbesserungen versprochen. Ob diese je umgesetzt werden können, ist fraglich. Aber selbst wenn die Neuentwicklungen halten, was Saab verspricht, wäre der Gripen immer noch weniger leistungsfähig als die F/A-18: Es gibt keine Zweisitzer-Version des Gripen. Solche Flugzeuge sind für die Ausbildung sehr wichtig, und die Ausschreibung hätte eine solche Version vorgesehen. Saab hat es aber nicht geschafft, eine solche Variante zu vernünftigen Preisen zu entwickeln. Die Reichweite des Gripen ist viel zu gering. Wenn der Jet von Payerne zu einem Luftpolizeieinsatz nach Davos aufbricht, müsste er schon nach wenigen Minuten über den Bündner Bergen wieder umkehren, weil ihm der Sprit ausgeht. Eine längere Einsatzdauer liesse sich nur mit Zusatztanks bewerkstelligen. Das wiederum würde bedeuten, dass auf anderes Equipment verzichtet werden müsste. Im Gegensatz zu den anderen evaluierten Flugzeugtypen verfügt der Gripen nur über ein Triebwerk anstatt zwei. Das macht den Jet nicht nur weniger leistungsfähig und weniger agil, sondern erhöht auch das Risiko von fatalen Unfällen.
Die Armee schanzt sich immer mehr Geld zu, bietet aufgrund fehlender Reformbereitschaft aber immer weniger eine taugliche Antwort auf neue sicherheitspolitische Herausforderungen. Von 2009 bis 2011 verfügte die Armee über einen Plafond von jährlich 4,1 Milliarden Franken, derzeit sind es 4,6 Milliarden, und ab 2016 sollen es gar 5 Milliarden sein. Das ist unhaltbar und ohne Giga-Beschaffung kaum zu rechtfertigen. So unsinnig der Kampfjetkauf ist, so gelegen kommt er, um ein überbordendes Armeebudget zu rechtfertigen. Dabei krankt die Schweizer Armee bereits am Fundament: Seit Jahren ist sich die Politik uneinig, in welche Richtung sich die Armee weiterentwickeln soll. Eine Reform jagt die nächste, und die Unklarheiten werden nie kleiner. Angesichts dessen ist die Milliardeninvestition in neue Kampfjets nicht zu vertreten. Kein gut geführtes Unternehmen würde Milliarden in ein Projekt mit hohen Risiken investieren, wenn gleichzeitig im Verwaltungsrat Unklarheit über die Strategie des Unternehmens vorhanden wäre. Die Reihenfolge muss heissen: zuerst Klarheit zur Ausrichtung schaffen und erst anschliessend in die Diskussionen über die Verwendung von Steuergeldern einsteigen.
Ein Nein zu neuen Kampfjets ist weder ein Nein zur Armee noch zur Luftwaffe, denn ein wirksamer Luftschirm ist auch ohne neue Jets gewährleistet. Die Schweizer Luftwaffe ist im internationalen Vergleich sehr gut gerüstet. Zur Erfüllung des Luftpolizei-Auftrags genügen die vorhandenen 32 F/A-18 längst. Die F/A-18-Flotte wurde ausserdem erst kürzlich für über 400 Millionen Franken technisch erneuert. Um die Erfüllung der luftpolizeilichen Aufgaben zu verbessern, braucht es eine verstärkte Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn. Im Alleingang können wir unseren kleinen Luftraum nicht mit vernünftigem Aufwand schützen – da können neue Kampfjets nichts beitragen.
Die neuen Jets machen viel Lärm, viel Lärm für nichts. Beim Start weist der Gripen eine rund dreimal höhere Schallintensität als der Tiger F-5 auf. Das ist für die betroffenen Standorte unerträglich. Auf dem Spiel stehen neben der Lebensqualität der Bevölkerung auch Tausende von Arbeitsplätzen im Tourismus. Papierflieger stürzen eher früher als später ab. Mit Ihrem Nein zu neuen Kampfjets sorgen Sie dafür, dass der Gripen in der Schweiz gar nicht erst abhebt.
Artikel erschienen in der NZZ vom 24. März 2014