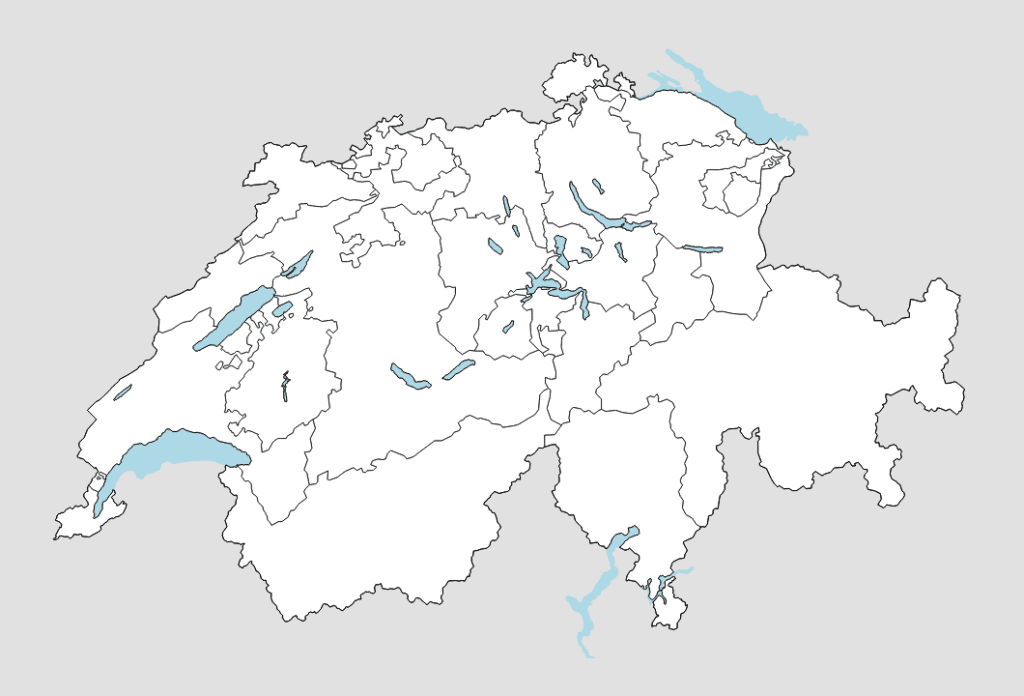Klar ist, dass es eine Revision braucht, die das unhaltbare Privileg der Statusgesellschaften aufhebt – und mit einer schlanken Patentbox dafür sorgt, dass Holdings und andere betroffene Statusgesellschaften hierbleiben können. Die Behauptung der Befürworter, zu dieser Reform gäbe es keine Alternative, ist aber völliger Mumpitz. Deshalb operieren die Befürworter jeglicher Couleur mit simplen Erpressungsparolen: Seid ihr nicht willig, so gehen Zehntausende Arbeitsplätze bachab. Das ist kompletter Kabis. Und ebenso falsch wie viele andere Behauptungen rund um die Unternehmenssteuern auch.
Die Folge in den Kantonen
In einem sind sich BefürworterInnen und Gegner einig: Die Reform kostet allein die Kantone und Gemeinden in der Schweiz mindestens zwei Milliarden Franken. Und das in einer Zeit, in der die Mehrheit der Kantone und viele Gemeinden auch ohne diese Ausfälle Defizite schreiben. Damit sie ihre Gewinnsteuern senken können, haben die Kantone dem Bund jährlich 1,1 Milliarden Franken abgetrotzt. Das Dumme daran: Der Bund hat diese Milliarde gar nicht. Er wird sie einsparen müssen.
Es ist dieses Geld, das dann den Kantonen fehlen wird. Der Bund hat bereits gegen den Widerstand der SP die Prämienverbilligungen für die kommenden Jahre um 75 Millionen Franken gekürzt. Das war erst der Anfang. Die zehn Millionen Franken, die die Basler Regierung als zusätzliche Prämienverbilligungen einsetzen will, werden im dümmsten Fall also nicht einmal das entstehende Loch stopfen.
Abzüge à gogo
Stark bluten wird auch die Bildung. Die Bildungsausgaben mussten schon jetzt gebremst werden. Sie wachsen jetzt weniger stark als die Studierenden zahlen. Die wegen der Schuldenbremse nötigen Einsparungen von 1,3 Milliarden jährlich werden den Forschungsstandort Schweiz und besonders Basel hart treffen: Der Bund finanziert 20 Prozent der Unis, 30 Prozent unserer Fachhochschulen und 25 Prozent der Berufsbildung. Besonders hart wird das unsere Universität treffen, die wegen der Baselbieter Finanzlage vor unsicheren Zeiten steht. Auch der ETH wird es ans Eingemachte gehen. Sie wird zuerst an den kantonalen Aussenstellen sparen, das hat sie bereits angetönt – und eine davon ist in unserer Region! Und die Aufstockung der Grenzwächter können wir gleich vergessen.
Besonders ärgerlich: Die Ausfälle der jetzigen Vorlage wären gar nicht nötig. Insbesondere die neuen Steuerabzüge haben nichts mit der Lösung des Statusproblems zu tun.
Die «zinsbereinigte Gewinnsteuer» zum Beispiel lässt sich Normalsterblichen gar nicht erklären: Weshalb sollen Unternehmen fiktive Zinsen abziehen dürfen, die sie nie bezahlt haben, Private aber nicht? Es ist eine Subvention für überschüssiges Kapital. Das schafft Anreize für Konzerne, Kapital in der Schweiz zu bunkern, um so immer höhere Abzüge geltend machen zu können. Die grosse Mehrheit der Kantone und der Bundesrat waren strikt gegen diesen Steuerabzug. Allein das kostet eine Viertelmilliarde – und zwar pro Jahr. Geld, das der Bund ebenfalls einsparen muss. Und zwar erneut auf Kosten der Kantone.
Die Schweiz wird nicht zurück in die Steinzeit geschickt, wenn die Reform bachab geht.
Noch absurder wird es bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung: Für jeden Franken, den ein Unternehmen in Forschung und Entwicklung investiert, sollen neu 1.50 Franken abgezogen werden können. Das ist schlicht eine Subvention. Versuchen Sie mal als Privatperson Ihre beruflichen Weiterbildungskosten zu 100 Prozent, geschweige denn zu 150 Prozent abzuziehen. Wo bleibt da die Steuergerechtigkeit?
Auch die Patentbox ist zu einem Scheunentor für Steuerabzüge verkommen. Anstatt sich auf Gewinne aus echten Patenten zu beschränken, hat die Mehrheit in Bern Gewinne aus Software und nicht patentierbaren Erfindungen von KMU ebenfalls hineingepackt. Bis zu 90 Prozent der Gewinne sollen dann steuerfrei sein. Diese weit gefasste Patentbox ist ein Blindflug für die Steuer behörden, ein Eldorado für Juristen, Bürokraten und Steuerberater.
Kurz: Die Kantone können den Firmen gesamthaft einen Steuerrabatt von bis zu 80 Prozent gewähren und hochrentable Unternehmen gegenüber Haushalten enorm bevorzugen. In der Stadt Lausanne müsste ein Ehepaar mit einem steuerbaren Einkommen von 80 000 Franken gleich viel Kantonssteuern bezahlen wie ein erfolgreiches Unternehmen, das einen Gewinn von einer Million ausweist. In Basel Stadt dürfte das in eine ähnliche Richtung gehen: Künftig soll keine Firma mehr als 13 Prozent Gewinnsteuer bezahlen – und zwar mit direkter Bundessteuer. Für Haushalte hingegen gilt weiterhin ein Steuersatz von 22,25 Prozent – und zwar ohne direkte Bundessteuer, die noch obendrauf kommt. Soziale Marktwirtschaft sieht anders aus.
Grossaktionäre statt Mittelstand
Die bürgerliche Mehrheit hat nicht nur bei den Abzügen übertrieben. Sie hat sich auch geweigert, die Milliardenausfälle gegenzufinanzieren, obwohl das der Bundesrat ursprünglich versprochen hat: Schweizweit wird das Ergebnis sein, dass der Mittelstand die Kosten berappen muss, entweder durch Leistungsabbau oder durch Steuererhöhungen. Die Grossaktionäre hingegen freuts, denn ihre Dividenden, die sie seit der USR II nur noch zur Hälfte versteuern müssen, werden durch die vielen Steuerschlupflöcher steigen.
Diese Steuerbefreiung war einer der grossen Fehler der USR II und hat dazu geführt, dass viele Betriebsinhaber ihre Firma in Aktiengesellschaften umgewandelt haben, um sich Dividenden statt Löhne auszuzahlen. Damit sparten und sparen sie nicht nur Steuern, sondern auch AHV Beiträge – was unsere AHV schwächt. Es ist kein Zufall, dass Bürgerliche das nicht korrigieren, sondern lieber die AHVRenten kürzen wollen. Sie geben lieber den Grossen als den Kleinen: So konnte sich etwa der in der Schweiz lebende Glencore Grossaktionär Ivan Glasenberg 2012 steuerfreie Dividenden in Höhe von 109 Millionen Dollar ausrichten lassen. Ist es wirklich eine solche Schweiz, die wir wollen?
Vergessen Sie die Erpressungsparolen. Die Schweiz wird nicht zurück in die Steinzeit geschickt, wenn die Reform an der Urne bachab geht. Im Gegenteil: Erst das Nein zu dieser Vorlage macht den Weg frei für eine schlanke Patentbox, die es in Basel tatsächlich braucht. Das ist nicht nur besser für Basel, es ist auch besser für die Schweiz.
Erschienen in der Basler Zeitung vom 13. Januar 2017