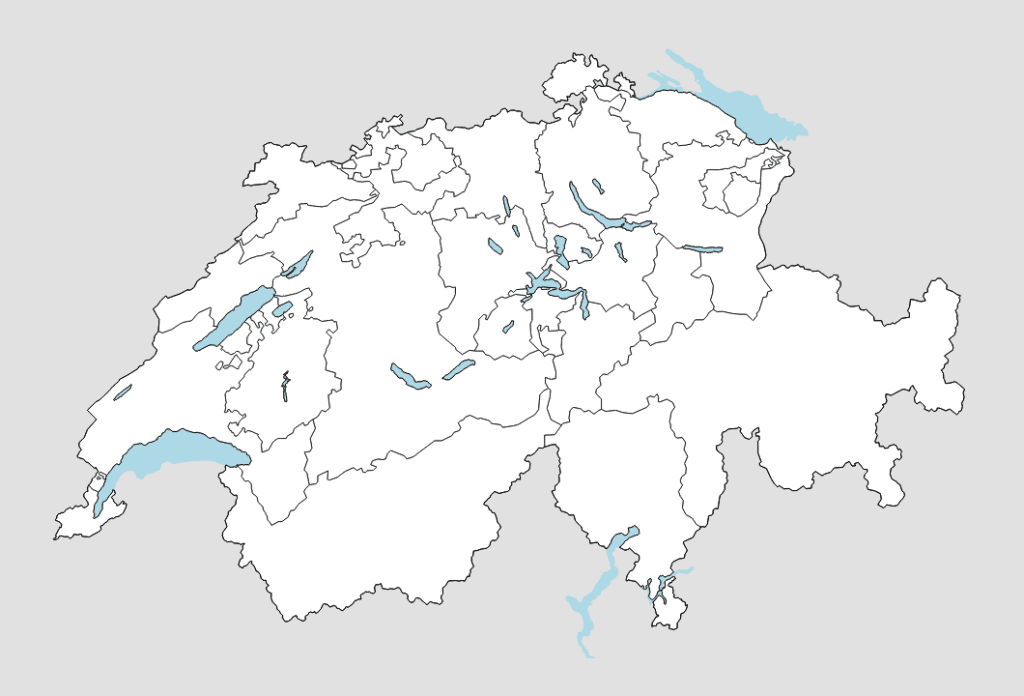Liebe Genossinnen und Genossen
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Der „Zürcher Unterländer“ hat schon gestern gemutmasst, dass ich heute nochmals alle „darauf einschwören“ würde, beim Mindestlohn„ ein dickes Ja auf den Zettel zu schreiben“. Da will ich den Unterländer auch nicht enttäuschen, nicht um seine Vermutung zu bestätigen, sondern weil der Mindestlohn tatsächlich so viele Anliegen zur sozialen Gerechtigkeit vereint, dass ich mich auch gar nicht davon abbringen lassen will.
Euch muss ich ja nicht davon überzeugen, wie notwendig der Mindestlohn ist. Wer sich von der Propaganda der Gegner allenfalls noch hat verunsichern lassen, der hat letzte Woche endgültig Beweis genug erhalten. Die entwürdigende Lohnpolitik in den Tieflohn-Branchen ändert sich nur, wenn sie zu fairen Löhnen gezwungen werden: Die Lohnschere geht weiter und weiter auf. Bei den 10 Prozent der Personen, die am wenigsten verdienen, sind die Löhne in den letzten Jahren gesunken. Das sei eben die Folge des schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes, sagen uns die Wirtschaftsverbände. Bei den 10 Prozent, die die höchsten Einkommen beziehen, sind die Löhne aber trotzdem innerhalb von 3 Jahren um 7 Prozent gestiegen. Nichts von Finanzkrise, Restrukturierung und anderem mehr, die Kaderlöhne wachsen munter weiter, trotz Gewinneinbussen und Arbeitsplatzabbau.
Gerade diese 10 Prozent Höchstlohn-Vertreter sind aber diejenigen, die in der Kampagne als Gegner des Mindestlohnes auftreten und uns weismachen wollen, dass sich alle etwas bescheiden müssen, gerade sie, die im sechs- und siebstelligen Frankenbereich verdienen.
Die Topshots der Schweizer Wirtschaft, die sich in der Economiesuisse treffen, tauschen sicher ihre Erfahrungen mit dem leeren Portemonnaie in der Monatsmitte aus, den Ausständen bei der Miete, der unbezahlten Krankenkassenrechnung und den Steuerschulden. Das macht sie auch so kompetent, um zu bestimmen, wie beschämend tief ein Lohn sein darf.
Genau diese setzen sich dafür ein, dass die Arbeitszeiten länger werden, die Renten gekürzt, das Rentenalter erhöht, dass die Frauenlöhne weiterhin diskriminierend viel tiefer sein dürfen und die Einführung einer GAV-Pflicht in vielen Branchen erfolgreich verhindert wird. Sie wollen, dass Zehntausende ….
– auch bei einem 100% Arbeitspensum
– auch bei abgeschlossener Berufslehre
– auch wenn sie älter als 25 Jahre sind
…. nicht den Lebensunterhalt für sich und ihre Familie bestreiten können.
Diejenigen, die jeden Franken, den die öffentliche Hand ausgibt argwöhnisch beobachten, machen aber die hohle Hand, damit der Staat mit Ergänzungsleistungen die Tief-Löhne ausgleicht. 100 Millionen Franken jährlich – so wird gerechnet – müssen jedes Jahr von den Gemeinden als Ergänzungsleistungen ausbezahlt, damit Personen, die trotz Arbeit ihre Wohnung, ihre Krankenkassen-Prämien, ihren Lebensgrundbedarf decken können. Als Gemeindepräsident ärgere mich, dass wir mit Sozialhilfe-Geld die Firmengewinne subventionieren müssen. Und es beschämt mich, dass Menschen gezwungen werden, trotz vollem Arbeitspensum noch auf dem Sozialamt um Hilfe nachzusuchen.
Wo bleibt da der Aufschrei all der KMU-Betriebe, die faire Löhne zahlen und mit ihren Steuern gleich noch die Tieflöhne ihrer Konkurrenten ermöglichen und ergänzen.
Immer wieder müssen wir uns anhören, dass bei uns die Löhne sowieso schon viel zu hoch sind verglichen mit den Löhnen im Ausland.
Wer sorgt dann aber dafür, dass wenigstens die Preise für die Produkte des täglichen Bedarfs auch nicht höher sind, dass die Wohnungsmieten nicht höher sind als im Ausland, die Krankenkassenprämien weniger schnell steigen?
Die gleichen Parteien, die den Mindestlohn bekämpfen, sind in der Frühlingssession auf die Revision des Kartellrechts gar nicht eingetreten. Ein Ziel der Revision wäre gewesen, dafür zu sorgen, dass die gleichen Produkte in der Schweiz nicht massiv mehr kosten als im Ausland. Weil das die Gewinne einiger weniger geschmälert hätte, müssen wir alle nun weiterhin zu hohe Preise für viele Produkte zahlen.
Und bei den Mieten das gleiche Spiel. Die Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus wird bekämpft, so dass die Mieten trotz sinkender Teuerung weiter steigen. Auch das führt dazu, dass die öffentliche Hand mit Mietzuschüssen den privaten Immobilienbesitzern ungerechtfertigt hohe Gewinne garantieren muss. Dieses Geld wäre so viel gescheiter und nachhaltiger bei den Wohnbaugenossenschaften angelegt.
Die Löhne tief, die Preise hoch, die öffentliche Hand als Garant für die privaten Gewinne. Das ist der Gegenentwurf der Wirtschaftsverbände zu unseren Initiativen für mehr soziale Gerechtigkeit. Der Mindestlohn ist jetzt dran, dann folgen die Initiative für eine öffentliche Krankenkasse, die Erbschaftssteuerinitiative, die Abschaffung der Pauschalsteuer für reiche Ausländer, die AHVplus-Initiative und weitere mehr.
In der Frühlingsession hat nach dem Ständerat auch der Nationalrat beschlossen, dass Schweizer Waffen auch in Gebiete geliefert werden dürfen, in denen die Menschenrechte missachtet werden. Auch die C-Parteien, die sich sonst heuchlerisch auf die christliche Tradition berufen, haben wacker mitgeholfen, dass nun wieder Schweizer Qualitäts-Waffen gegen Regierungsgegner, gegen Freiheitskämpfer und Unterdrückte eingesetzt werden können. Hingeschaut wird nur beim Einkassieren der Gewinne. Dank dieser Waffenlieferungen werden humanitäre Katastrophen erst möglich, werden Menschen aus ihrer Heimat vertrieben, werden Menschen verstümmelt und werden Menschen gequält.
Für die Folgen, die die Waffen-Exporteure anrichten, ist dann wieder die andere Schweiz zuständig: Die humanitäre Schweiz, die Hilfswerke, die Kirchen.
Die Kriegsgewinnler sind mitverantwortlich, dass Millionen von Menschen auf der Flucht sind. Sie sind auch die ersten, die aber aufschreien, dass das Boot nun voll sei, dass weder Platz noch Geld für Flüchtlinge vorhanden wäre.
Wir Linken sind hier gefordert und wir müssen uns wieder aktiver gegen Militarismus und Waffenexporte positionieren. Wenn wir zulassen, dass mit dem Argument der Arbeitsplätze die Not der anderen produziert wird und die Hilfesuchenden im Stich gelassen werden, verlassen wir unsere Tradition der internationalen Solidarität. Denken wir daran, Ausgrenzung beginnt immer mit einer Minderheit und schnell folgen andere.
Ganz aktuell erleben wir hautnah, dass die Fahrenden keine Standplätze in der Schweiz finden. Mit Behördenwillkür wird eine Schweizer Minderheit ausgegrenzt und das Selbstbestimmungsrecht einer Volksgruppe missachtet.
Dass bald wieder Ausländer-Kontingente, geordnet nach Regionen, Herkunft, Ausbildung, Familien, Vermögen und weiteren Kriterien gebildet werden sollen, ist absolut diskriminierend und muss im Ansatz bekämpft werden. Die Vertreter der Wirtschaft – und auch für die Befürworter der Masseneinwanderungs-Initiative – verlangen, dass alleine der wirtschaftliche Nutzen und die Gewinnmöglichkeiten die Höhe der Zuwanderung bestimmen sollen. Wenn es in ihr Gewinnschema passt, dann aber bitte unbegrenzt.
Wir lassen uns nicht mehr zurückwerfen in die Zeit der 60er Jahre, als die Arbeitskräfte gerufen wurden und Menschen gekommen sind. Als Barackendörfer an den Dorfrändern eine klare Grenze zwischen Einheimischen und Gastarbeitern bildete. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich als Kind mit anderen Kindern hinter Kellerfenstern Kontakt aufzunehmen versuchte. Kinder, die nicht ins Freie durften, die von ihren Eltern versteckt werden mussten. Lange habe ich geglaubt, dass wir diese Schande vertrieben hätten, jetzt steht sie wieder vor der Tür.
Jetzt ist die linke Solidarität gefragt und sie darf nicht bei Lippenbekenntnissen bleiben. Wir Linken haben in einigen der vergangenen Volksabstimmungen den populistischen Forderungen zu wenig entgegengesetzt. Wir haben uns selber verunsichern lassen und uns für die Verunsicherten zu wenig eingesetzt und nicht vermocht, Drohungen, falsche Anschuldigungen und Verängstigungen zu entkräften. Wir haben zwar regelmässig flankierende Massnahmen verlangt, gegen das Lohndumping, für mehr zahlbare Wohnungen, zum öffentlichen Verkehr. Wir müssen uns aber eingestehen, bei Betrachtung der letzten Abstimmungsresultate ist uns das bei vielen Menschen nicht gelungen, wir konnten die betroffenen Menschen bei ihren Sorgen schlicht nicht abholen.
Wir haben bei uns noch das Kassabuch der SP Rümlang aus den 1920er Jahren. Wenn ich darin blättere, kann ich leicht feststellen, dass die Linke in jenen Jahren den Mitgliedern auch existenzielle Hilfe angeboten hat. Nicht wenige konnten finanzielle Überlebenshilfen in Anspruch nehmen. Die SP war auch eine Versicherung; nicht nur für finanzielle Hilfe, auch Schutz gegen Ausgrenzung in der Gemeinde, Unterstützung in der Bildung und Erziehung, Schutz gegen die Vereinnahmung durch Populismus und Militarismus. Und mit der Hilfe zur Selbsthilfe auch gegenseitige Unterstützung, zum Beispiel organisiert im genossenschaftlichen Konsumverein oder der Wohnbaugenossenschaft.
Wir müssen uns wieder in Erinnerung rufen, dass der soziale Zusammenhalt in der Schweiz unser Verdienst ist und dass ohne uns keine Sozialpolitik mehrheitsfähig ist. Die AHV, die IV, die Arbeitslosenversicherung, das Umweltrecht, der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, das Krankenversicherungsgesetz führt uns Bewohnerinnen und Bewohner der Schweiz näher zusammen als die Glorifizierung der Landesverteidigung, die Bilder einer vermeintlich heilen Welt der Berglandwirtschaft oder die Schoggiproduktion. Die internationale Solidarität eint uns mehr als die unheimlichen Patrioten, die uns ein Kampfflugzeug schmackhaft machen wollen, von dem wir weder die Notwendigkeit, noch die Flugtüchtigkeit noch die Einsatzmöglichkeiten kennen. Unsere humanitäre Tradition eint uns mehr, als der verlorene Kampf für ein Bankgeheimnis, das wenige sehr reich und viele zu Opfer der Finanzkrise gemacht hat.
Ja, die soziale Gerechtigkeit und die Stärke eint die Schweiz. Dort wo die Linke stark ist, gibt es höhere Lebensqualität, weniger Gerangel um mehr oder weniger Solidarität, weniger Ausgrenzung und weniger Fremdenfeindlichkeit, dafür ein vielfältigeres Kultur- und Erholungsangebot.
Darum müssen wir Linke wieder mit mehr Selbstbewusstsein unsere Stärken für die Verbesserung unserer Lebensumwelt, für bezahlbaren Wohnraum, für eine öffentliche Krankenkasse, eine gerechte Erbschaftssteuer, für Generationensolidarität und für gerechte Löhne aufzeigen. Damit werden wir auch ausserhalb der städtischen Zentren zur bestimmenden politischen Kraft und zu einer solidarischen Gesellschaft. Gemeinsam packen wir‘s an.
Ich wünsche uns allen einen schönen 1.Mai.