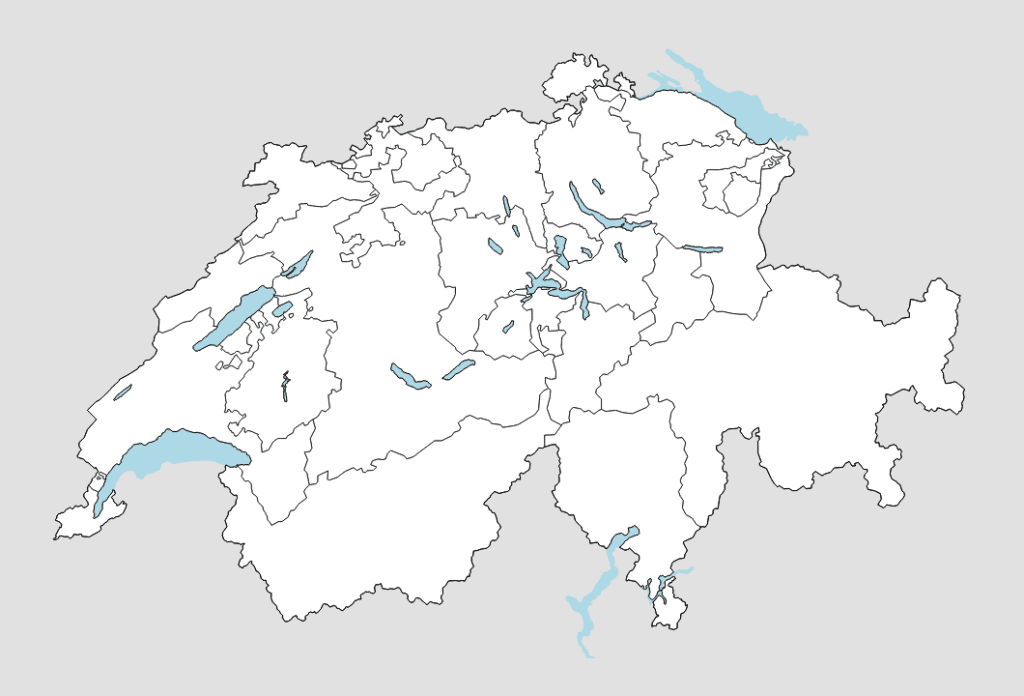Von Samira Marti und Joël Bühler
Ob die extreme Mitte wie die Operation Libero oder rechtsliberale FDP: Für Bürgerliche ist die Schweiz ein richtiges Wohlfühlland. Einige sprechen vom bereits existierenden «Erfolgsmodell», andere eher vage vom «Chancenland». Zynisch ist beides. Vor zwei Jahren traten die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) in Kraft, diese sollen bis 2030 erreicht werden. Sie sind das wichtigste und ambitionierteste Projekt, um den Lebensstandard der Menschheit zu erhöhen. Zu den Zielen gehört, dass wir Armut und Hunger besiegen, die Gesundheit verbessern, mehr und besser bilden, Ungleichheiten reduzieren und Diskriminierungen beenden. Wir müssen den Klimaschutz verschärfen, Frieden stiften und den Menschen gute Arbeit ermöglichen. Doch unser «Erfolgsmodell» oder «Chancenland» sabotiert diese Entwicklungen.
Vor einigen Monaten haben der bekannte Entwicklungsökonom Jeffrey Sachs und die Bertelsmann-Stiftung eine Studie publiziert. Das Ergebnis: Die Schweiz hindert andere Gesellschaften stärker als jedes andere Land daran, die SDG zu erreichen. Die sogenannten negativen Spillovers – also negative Effekte der Wirtschaftsweise in einem Land auf andere Gesellschaften – sind nirgends grösser als in der Schweiz. Nur Öldiktaturen oder die aggressiven und umweltzerstörerischen USA wälzen fast so viele Kosten auf andere ab.(1) Aber wie genau schadet die Schweiz anderen Ländern?
Besonders schlimm steht es um die Schweizer Finanz- und Wirtschaftspolitik – also den ideologischen Kern von «Erfolgsmodell» und «Chancenland». Selten ist der Finanzplatz so verschwiegen wie in der Schweiz – damit wird Steuerhinterziehung und Kapitalflucht aus den Ländern des Südens beschleunigt und den Volkswirtschaften dringend benötigtes Kapital geraubt.(2) Mit den Raubzügen nach Steuersubstrat sabotiert die Schweiz dort Gesundheitsversorgung, öffentliche Güter und Klimaschutz.
Neben neoliberaler Wirtschaftspolitik zählt zum Verständnis bürgerlicher Parteien die Vorstellung, dass durch harte Arbeit jede und jeder den Aufstieg schaffen kann. Das trifft schon in der Schweiz nicht zu, die soziale Mobilität ist bei uns wesentlich tiefer als in Ländern mit stärkeren Sozialstaaten und Gewerkschaften wie Dänemark oder Schweden.(3) Richtig dreist wird die Behauptung aber, wenn man die von der Schweiz durch Importe verursachten Arbeitsbedingungen ansieht. Mit 2.8 Toten pro 100’000 Arbeiter*innen tötet die Produktion unserer Produkte im Ausland so viele Menschen wie nur diejenige für Unrechtsstaaten.(4) Unser Wohlstand ist eher auf tödlichen Unfällen als auf sozialen Aufstiegen aus dem Bilderbuch gebaut. Dazu gefährden wir Sicherheit und Menschenleben auch durch Waffenexporte.
Auch bezüglich sich verschärfender Klima- und Umweltkrise ist die Politik der Schweiz katastrophal. Bei der Gefährdung der Biodiversität im Ausland verteidigen wir unseren unrühmlichen Spitzenplatz. Bei den importierten CO2-Emissionen gibt es zwar etwa 30 Länder, die noch mehr schaden. Die Schweiz ist aber alles andere als eine Musterschülerin und gehört zu den schlimmsten Klimasaboteurinnen.
Was haben diese Politiken gemeinsam? Würden alle Gesellschaften ihre Wirtschaft so aufbauen, die Weltgemeinschaft würde in noch mehr Kriegen, Hungersnöten und ökologischen Katastrophen versinken. Das Verhalten der Schweiz ist nicht verallgemeinerbar. Doch was bedeutet das für uns? Markus Wissen und Ulrich Brand nennen solches Wirtschaften die «imperiale Lebensweise»: Länder im globalen Norden leben mit einem hohen Lebensstandard, lagern aber die Kosten für diesen Lebensstandard an Gruppen im Inland, vor allem aber in den globalen Süden aus. Im Inland sind das in der Schweiz vor allem Frauen*, die weiterhin mit unbezahlter Care-Arbeit die Grundlagen für die Wirtschaft zur Verfügung stellen. Im Ausland sind es die Menschen, die durch miserable Arbeitsbedingungen, Kriege, Umweltkatastrophen oder wirtschaftliche Unterentwicklung direkt von unserer Politik geschädigt werden.
Natürlich sind wir nicht alle dafür verantwortlich: Wer von Lohn und Rente im Norden der Welt lebt, kann oft nicht anders, als imperial zu leben. Unsere Siedlungsstruktur, unser Mobilitäts- und unser Energiesystem setzen uns enge Grenzen, wie viel CO2 wir einsparen können.(5) Wer aber Profite zu maximieren versucht und dabei andere Menschen ausbeutet, macht dies bewusst und willentlich. Doch solange die Profite sprudeln, verteidigt das Kapital die imperiale Schweiz. Dagegen müssen wir uns einsetzen.
Für eine solidarische Welt müssen wir zuerst gegen unser klimaschädliches Finanzsystem vorgehen. Aber auch im Inland müssen wir von der imperialen Lebensweise wegkommen: Wir können die Probleme durch E-Autos nicht einfach verlagern.(6) Wir brauchen stattdessen einen Mobilitätswende, besonders einen massiven Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und des Langsamverkehrs, autofreie Städte und guten ÖV auf dem Land. Wer unsere globale Verantwortung nicht komplett missachtet, kommt zum Schluss: Nur mit einer umfassenden Transformation kommen wir weg von der imperialen Lebensweise und hin zu einer solidarischen Welt.
______________________________________
(1) Ausgenommen die Kleinstaaten Luxemburg und Singapur
(2) Nur Zypern, Luxemburg, die Niederlande, das Vereinigte Königreich, Irland und Kanada haben eine schlimmere Steuerpolitik
(3) OECD (2018): A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility.
(4) San Marino, Guyana, Singapur, Kuwait, Luxemburg, Vereinigte Arabische Emirate und Mauritius
(5) Mit dem perfekten, ökologischen Lebensstil kann ein*e Schweizer*in gerade mal auf den durchschnittlichen globalen CO2-Fussabdruck hinunter kommen – viel zu viel, um die Absenkungspfade zu erreichen
(6) E-Autos senken zwar den CO2-Ausstoss, führen aber zur Enteignung der indigenen Bevölkerung im Süden, total verschmutzten Landschaften und neue Ressourcenkonflikten. Siehe hierzu bspw. die Dokumentation des westdeutschen Rundfunks und der ARD, “Kann das Elektro-Auto die Umwelt retten”