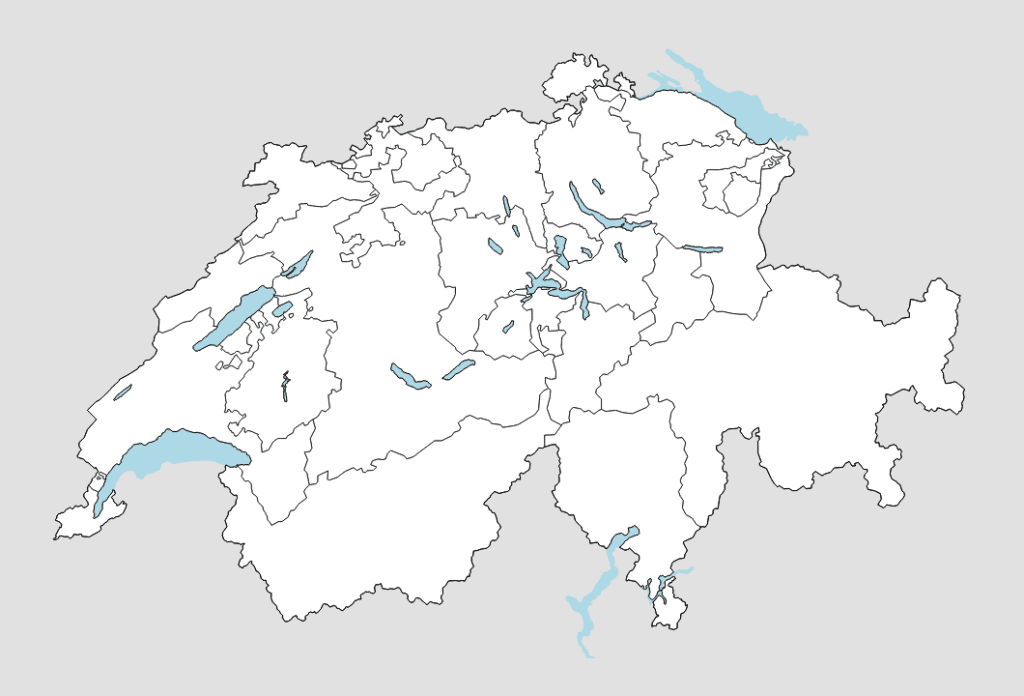Wer sich heute fragt, ob mit der 1:12-Initiative die Lohnexzesse insbesondere in der Finanz- und Pharmaindustrie wirklich gestoppt werden, der sei nochmals daran erinnert, wie diese Millionensaläre in der Vergangenheit gerechtfertigt wurden. Vor der globalen Finanzkrise, die vor fünf Jahren die Welt erschütterte, war die Erklärung der Top-Shots am Paradeplatz banal: «Wir verdienen diese sieben- und achtstelligen Summen, weil wir Mehrwert schaffen. Mehrwert in Form von Shareholder-Value.» Zwar hegte ich wie viele andere schon damals Zweifel, ob es wirklich an den Rechen- und Planungskünsten einiger Einzelpersonen liegen konnte, dass an der Börse innert kürzester Zeit heisse Luft in Milliarden verwandelt werden konnte. Aber bis zum grossen Crash fehlte der überzeugende Gegenbeweis.
Mit der Krise, die einzelnen Banken das Genick brach und viele andere nur dank Staatshilfe überleben liess, folgte die brutale Entlarvung: Jene, die jetzt innert Wochen Milliarden an Unternehmenswert vernichteten, wollten immer noch ihre Millionen, als wäre nichts geschehen. Und erhielten sie auch. Plötzlich hatte die lausige Performance des Unternehmens nichts mehr direkt mit ihnen als Manager zu tun. Verantwortlich für das Debakel waren jetzt externe Faktoren: die Zinsen, die Märkte – und am Schluss natürlich der Staat aufgrund falscher Regulierungen. Privatisierung der Gewinne und Sozialisierung der Verluste, hiess das Motto. Über Nacht war in der Debatte über eine gerechte Lohnverteilung innerhalb eines Unternehmens nicht mehr von Leistung die Rede. Die neuen Schlagworte waren «Neid» und «Standort»: Wer das fürstliche Salär seines obersten Chefs beklagt, den wurmt nur, dass er es nicht selbst ganz nach oben gebracht hat. Und nur wenn wir diese international gefragten Leistungsträger mit Entschädigungsmodellen wie an der Wall Street für uns gewinnen können, prosperiert unser Finanz- und Werkplatz, so die beiden Thesen. Beide verkennen die Schweizer Realität.
Der Neid-Vorwurf impliziert, dass die Höhe des Einkommens reine Privatsache ist – Privatisierung der Gewinne eben. Im Fall eines Misserfolgs büsst aber das ganze Unternehmen oder die Gesellschaft – Sozialisierung der Verluste. Die finanzielle Verantwortung trägt ja sowieso nicht der CEO, da er nicht mit seinem eigenen Kapital, sondern bestenfalls mit seinem Ruf haftet, wenn ihm der Abgang mit einem goldenen Fallschirm noch versüsst wird.
Ein CEO ist kein absolutistischer Alleinherrscher. Ein Unternehmen ist vielmehr so erfolgreich wie die Summe seiner Mitarbeitenden. Darum ist der Verteilungsaspekt innerhalb eines Unternehmens keine Frage des Neids, sondern der Gerechtigkeit. Weil nämlich alle im Betrieb zur Wertschöpfung des Unternehmens beigetragen haben, der Lernende und die Hilfsarbeiterin genauso wie die Damen und Herren der Teppichetage. Mit gutem Recht stellt der «kleine» Mitarbeitende die Frage, ob sein Chef wirklich 50- oder 100-mal leistungsfähiger ist – oder ob er einfach so tief in die Schatulle greift, bis ihn jemand zur Rede stellt.
Die Vorstellung, dass diese Verteilungsgerechtigkeit innerhalb eines Unternehmens mit einem Verhältnis von 1:12 gegeben wäre, ist weder neu noch extrem: 1984 verdienten die Chefs der grössten Schweizer Unternehmen rund sechsmal mehr als ein sogenannter Normalverdiener, und auch 1998 betrug dieses Verhältnis erst 1:13, bevor es dann auf 1:43 emporschnellte (2011). Was über Jahrhunderte als Erfolgsmodell Schweiz galt – Mass halten und keine Exzesse –, wurde von smarten Beratern und Headhuntern neu als antiquiert und hinterwäldlerisch verunglimpft. Aber ist der Leistungsunterschied zwischen dem einfachen Büezer und seinem obersten Chef wirklich innert weniger Jahre explodiert? Oder ist es einfach an der Zeit, die angelsächsischen Exzesse seit der Jahrhundertwende moderat zu deckeln?
An dieser Stelle werfen die Gegner dieser Initiative das Standort-Argument ein: Alle, die bei Annahme der Initiative eine Reduktion ihres Salärs befürchten, würden über Nacht dem Land den Rücken kehren. Ist dem wirklich so? Und würde die Schweiz die angeblich besten Führungskräfte verlieren, nur weil künftig bei der Managerentlöhnung Mässigung auf höchstem Niveau gefragt wäre? Das zu behaupten, ist ein Affront gegen all jene Branchen des Werkplatzes, die trotz vollen Auftragsbüchern und florierendem Geschäft sich nicht überheblich an den Ackermanns und Ospels der Finanzwelt orientiert haben, sondern aus persönlichem, gesellschaftlichem oder wirtschaftlichem Verantwortungsgefühl Mass gehalten haben.
Ich wage zu behaupten, dass diese Führungskräfte den Fortbestand unseres wirtschaftlichen Wohlstands und des Erfolgsmodells Schweiz garantieren. Entsprechend erstaunt es auch, dass aus der Welt der KMU keine Einwände kommen, wenn quasi jeder Unternehmenschef belächelt wird, der für 500 000 Franken Jahressalär morgens überhaupt sein Bett verlässt. Es sind die Tugenden wie Loyalität, Engagement oder Verantwortungsgefühl, die die Wirtschaft bei der jungen Generation immer wieder einfordert. Aber ironischerweise sind es genau die Prädikate, die für die am teuersten bezahlte Führungsriege nur sehr beschränkt zutreffen.
Die 1:12-Initiative liefert uns nun seit einigen Wochen die Chance, all diese Fragen öffentlich und kontrovers zu diskutieren, und zwingt jeden CEO dazu, einmal selbst auszurechnen, wie viel mehr Leistung er im Vergleich zur Mitarbeitenden in der Kantine gemäss Lohnausweis liefern muss – oder liefern müsste. Es ist richtig, dass in einer perfekten Welt nicht der Staat, sondern die Aktionäre, das private Umfeld oder das eigene Gewissen dafür sorgen würden, dass es keine Begrenzung der Lohnspannbreite braucht. Solange das nicht so ist, muss uns der Verfassungsartikel der 1:12-Initiative noch nachhelfen.
Gastkommentar in der NZZ vom 30. September 2013