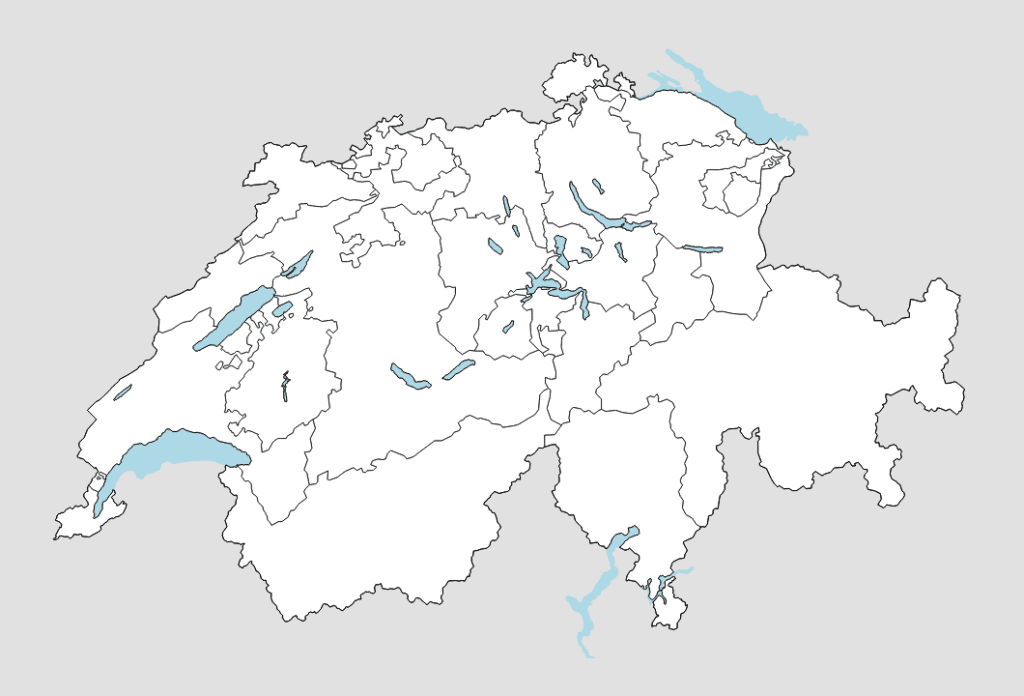Um den Kanton Bern auf dem Weg zu einer klimaneutralen Land- und Ernährungswirtschaft im Sinne des Netto-Null-Ziels voranzubringen, wird der Regierungsrat beauftragt,
1. die Treibhausgas-Emissionen des Sektors Landwirtschaft und ihren Beitrag zur Bindung
von CO2 namentlich in den Böden differenziert darzulegen und das Potenzial zur Verbesse-
rung dieser Bilanz aufzuzeigen
2. die Information, Aus- und Weiterbildung sowie Beratung der Landwirtinnen und Landwirte
zu verstärken und dafür vorhandenes Knowhow und Hilfsmittel aus der Berner Fachhoch-
schule BFH-HAFL, der Wyss Academy for Nature und aus bäuerlichen Organisationen zu
nutzen
3. ein Programm zur Förderung von landwirtschaftlichen Pilotbetrieben zu lancieren, die Mög-
lichkeiten zu klimafreundlicherer Tierhaltung, Bodennutzung, Verarbeitung und Vermark-
tung erproben wollen
4. die Massnahmen, die im Vortrag zum Klimaschutz-Artikel der Berner Kantonsverfassung
aufgelistet sind, vertieft zu prüfen und gegebenenfalls so rasch wie möglich umzusetzen
5. weitere Massnahmen vorzusehen, um den THG-Ausstoss auch in anderen Bereichen der
Ernährungswirtschaft zu reduzieren
Begründung:
Der Klimawandel ist für die Landwirtschaft eine doppelte Herausforderung: Sie muss sich dem
Klima anpassen und gleichzeitig klimaschädigende Emissionen reduzieren. Diese doppelte Her-
ausforderung ist auch in der Abstimmungsbotschaft zum Klimaschutz-Artikel zum Ausdruck ge-
kommen, der am 27. September 2021 vom Berner Volk mit klarer Mehrheit in der Kantonsver-
fassung verankert worden ist. Die Grossratskommission, die den Verfassungsauftrag zum Errei-
chen der Klimaneutralität bis 2050 ausgearbeitet hat, weist in ihrem Vortrag darauf hin, dass in
der Schweiz rund 13,5 Prozent der klimaschädigenden Treibhausgase (THG) aus der Landwirt-
schaft stammen. Eine vollständige Reduktion sei in diesem Bereich im Unterschied zu anderen
Handlungsfeldern jedoch nicht möglich. Deshalb seien «hier auch Massnahmen nötig, die CO2
binden, um so die Treibhausgasemissionen auf «Netto-Null» zu bringen». Im Unterschied zu
anderen Kantonen fehlt es im Kanton Bern bisher an einer übersichtlichen Darstellung der Prob-
lematik und der vorhandenen Lösungsmöglichkeiten im Bereich der Landwirtschaft (dies auch
im Unterschied zu anderen kantonalen Politikbereichen wie Energie, Gebäude und Verkehr).
Zu Punkt 1: Der Vortrag zum Klimaschutz-Artikel zählt die Landwirtschaft zusammen mit dem
Verkehr, Gebäuden und Industrie zu jenen Bereichen, in denen der Kanton Bern gesamthaft
mindestens 50 Prozent der CO2-Emissionen selber, über das kantonale Recht, beeinflussen
kann. Ausser im Gebäudebereich fehle es jedoch an kantonalen Daten über die THG-Emissio-
nen und ihre Entwicklung. Um diesen Mangel zu beheben, wird in Punkt 1 die Erarbeitung und
Erhebung statistischer Grundlagen verlangt. Die THG-Bilanz der Berner Landwirtschaft ist diffe-
renziert darzustellen, um von pauschalen (Vor-)Urteilen wegzukommen und die räumlichen Ge-
gebenheiten im Gras- und Bergland mitzuberücksichtigen (vgl. etwa das Sachbuch «Die Kuh ist
kein Klimakiller» und ähnliche Publikationen). Zu unterscheiden ist insbesondere zwischen dem
CO2-Ausstoss, der aus dem fossilen Energieverbrauch für Gebäude, Maschinen und Fahrzeuge
entsteht, und dem THG-Ausstoss aus der Tierhaltung (v. a. Methan, CH4) und der Bodennut-
zung (v. a. Lachgas aus der Stickstoff-Düngung, N2O). (Hinweis: Der Kanton Graubünden
schätzt, dass die THG-Emissionen der Bündner Landwirtschaft nur zu 8 Prozent auf den Ener-
gieverbrauch zurückzuführen sind − 92 Prozent stammen aus Tierhaltung und Bodenbewirt-
schaftung.) Ausserdem ist der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die Landwirtschaft über die
Erhöhung der Kohlenstoffspeicherkapazität der Böden und über die Produktion erneuerbarer
Energie auch positive Beiträge zum Erreichen der Klimaneutralität leisten kann.
Zu Punkt 2: Um der eingangs erwähnten doppelten Herausforderung gerecht zu werden, wird in
Punkt 2 eine Verstärkung der Information, Aus- und Weiterbildung sowie Beratung gefordert,
und zwar im Hinblick sowohl auf eine Reduktion des THG-Ausstosses als auch auf eine Anpas-
sung an den Klimawandel. Neben gravierenden Risiken und grossen Nachteilen, die es durch
frühzeitige Anpassung zu minimieren gilt, birgt der Klimawandel für die Landwirtschaft auch
Chancen, die es zu nutzen gilt (z. B. längere Vegetationsperioden). Die Bemühungen, nament-
lich des INFORAMA, sind auszuweiten und mit Vorrang voranzutreiben. Wo Zielkonflikte (z. B.
mit dem Tierwohl) bestehen, muss eine Interessenabwägung gemacht werden. Der Kanton
Bern kann in diesem Handlungsfeld von der Nähe zu zwei führenden Forschungsinstitutionen
profitieren: Die BFH-Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (HAFL) und
die international aktive Wyss Academy for Nature verfügen über viel Knowhow bzw. Mittel, um
die Berner Landwirtschaft auf ihrem Weg zu einer klimaneutralen Berner Land- und Ernährungs-
wirtschaft zu unterstützen. Auch aus bäuerlichen Organisationen liegen Hilfsmittel, gute Erfah-
rungen und ganze Kataloge von möglichen Massnahmen vor, die auch von und für die rund
9000 Berner Landwirtschaftsbetriebe genutzt werden könnten und sollten (vgl. zum Beispiel:
Energie- und Klima-Check für Landwirte und Massnahmenkatalog von AgroCleanTech:
www.energie-klimacheck.ch / IP Suisse-Punktesystem: www.bauern-fuer-klima-und-umwelt.ch /
Ideenkatalog von Klimaneutrale Landwirtschaft Graubünden: www.klimabauern.ch).
Zu Punkt 3: Im Kanton Graubünden ist aus bäuerlichen Kreisen das Projekt «Klimaneutrale
Landwirtschaft Graubünden» entwickelt worden. In einer Pilotphase testen 50 unterschiedliche
Betriebe (ausgewählt aus 120 Bewerbern!) bis 2025 ihre Möglichkeiten zur Reduktion der THG-
Emissionen, um dann als bäuerliche «Botschafter und Wegbereiter einer klimaneutralen Land-
wirtschaft» die flächendeckende Ausweitung der Bemühungen zu begleiten. Das bäuerliche
Projekt ist in den kantonalen Aktionsplan «Green Deal für Graubünden» aufgenommen worden,
den der Bündner Grosse Rat am 19. Oktober 2021 mit 93 gegen 17 Stimmen beschlossen hat.
Für die Pilotphase wurde ein Kantonsbeitrag von 6,4 Millionen Franken bewilligt und als lang-
fristige Vision formuliert: «Graubünden ist der erste Kanton der Schweiz, in dem die Konsumen-
tinnen und Konsumenten beim Kauf von Bündner Lebensmitteln die Gewissheit haben, dass
diese klimaneutral produziert worden sind.»
Der Kanton Bern wird in Punkt 3 aufgefordert, als stolzer und grösster Schweizer Agrarkanton
ähnliche Ambitionen wie Graubünden zu entwickeln und ein analoges Programm für bäuerliche
Pilotbetriebe zu lancieren. Mit einem solchen Programm könnte auch praxisnah aufgezeigt wer-
den, dass (und wie) sowohl konventionelle Betriebe als auch IP- und Biobetriebe wertvolle Bei-
träge zur Reduktion der THG-Emissionen leisten können und müssen. Damit könnte allen Ber-
ner Bauernbetrieben eine zukunftsfähige Perspektive vermittelt werden – nicht nur jenen, die
mit der kantonalen Bio-Offensive angesprochen sind.
Zu Punkt 4: Nach dem Volks-Ja zum Klimaschutz-Artikel in der Kantonsverfassung ist der Re-
gierungsrat auch aufgefordert, die von der Grossratskommission im Vortrag aufgelisteten Mass-
nahmen vertieft zu prüfen und möglichst auch rasch umzusetzen. Selbstverständlich soll mit der
Forderung von Punkt 4 nicht ausgeschlossen werden, dass auch weitere Massnahmen oder Al-
ternativen in Betracht gezogen werden, beispielsweise aus den umfassenden Strategie-, Pla-
nungs- und Aktionsplänen, die andere Kantone seit Mai 2021 publiziert haben (wie z. B. Kanto-
naler Klimaplan (FR), Klimakompass (AG), Aktionsplan Green Deal Graubünden (GR), Pla-
nungsbericht Klima- und Energiepolitik (LU).
Zu Punkt 5: Der kantonale Klimaplan des Kantons Freiburg beruht auf einer umfassenden
Klimabilanz, in der die Landwirtschaft als (wichtiger) Teil der Ernährungswirtschaft erfasst wird.
Er führt mit dieser erweiterten Optik 33 Prozent der direkten THG-Emissionen auf seinem Terri-
torium auf die Land- und Ernährungswirtschaft zurück. Er erklärt dies einerseits mit der grossen
Bedeutung des Landwirtschaftssektors und insbesondere der Milchwirtschaft im Kanton Frei-
burg, weist aber auch auf die grosse Klimarelevanz importierter Lebensmittel hin: Ihre (im Aus-
land verursachten) THG-Emissionen sind bedeutender als die durch Düngung im Kanton verur-
sachten Lachgas-Emissionen und fast so bedeutend wie der Methan-Ausstoss aus der Viehhal-
tung.
Diese Hinweise machen klar, dass auf dem Weg zur Klimaneutralität in der Berner Landwirt-
schaft auch andere Bereiche der Ernährungswirtschaft einbezogen werden müssen, namentlich
die ganze Produktionskette, Verteilung, Vermarktung und Konsum von Nahrungsmitteln. Kon-
krete Massnahmen zugunsten klimaschonender Agrarprodukte könnten insbesondere auch
nach dem Muster der Berner Bio-Offensive entwickelt und umgesetzt werden.
Insgesamt zielt der Vorstoss auf eine Ergänzung und Konkretisierung der Massnahmen ab, die
in der Umweltstrategie der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion WEU 2021 angelegt sind.
Der Kanton Bern ist als erster Kanton mit einem umfassenden Verfassungsauftrag zum Klima-
schutz aufgefordert, den Weg zu einer klimaneutralen Land- und Ernährungswirtschaft systema-
tisch und zielstrebig voranzugehen.