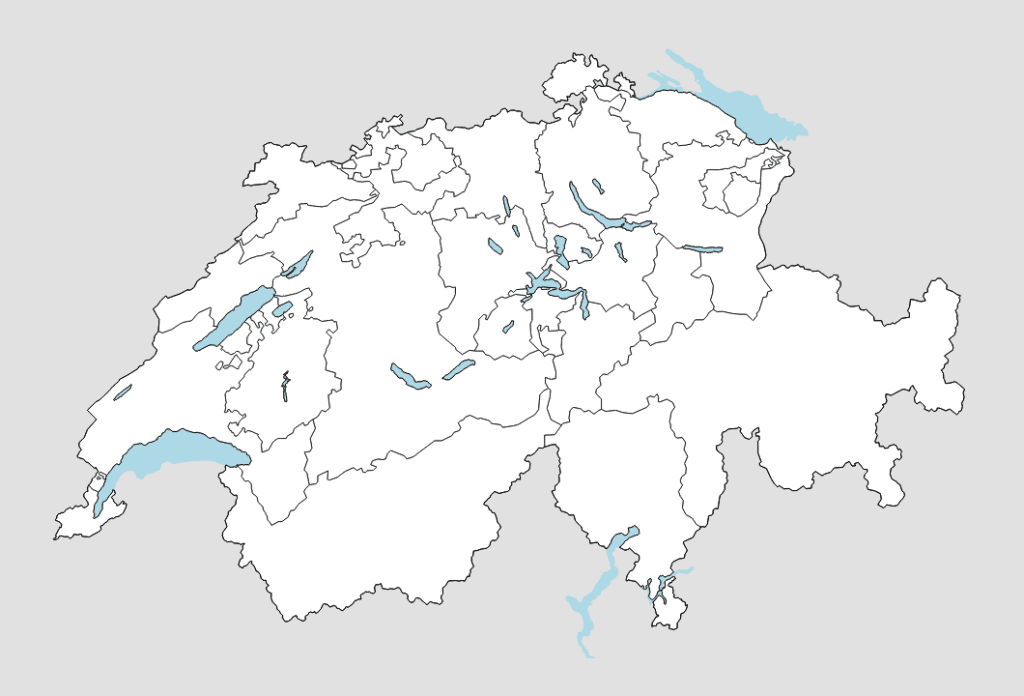Questions fréquentes
Le plus simple est de remplir en ligne le formulaire d’adhésion ci-contre.
Tu décides toi-même de l’engagement qui te convient le mieux.
- Si tu as peu de temps, il n’y a absolument rien de mal à ce que ton engagement se limite au paiement de ta cotisation. Ceci nous aide aussi à construire une Suisse et un monde meilleurs.
- La section à laquelle tu es affilié-e te demandera parfois, si tu as le temps, d’être présent-e sur stand, de récolter des signatures ou de participer à une action téléphonique. C’est toujours un plaisir lorsque nos membres s’engagent et s’impliquent – mais c’est bien sûr entièrement volontaire.
- La plupart des sections organisent régulièrement des assemblées générales pour discuter de thèmes et d’activités politiques actuels. La participation à ces réunions est bien sûr également totalement volontaire. Mais c’est toujours une occasion d’y rencontrer de nouvelles personnes.
- Si un thème te touche particulièrement, tu peux t’engager dans une commission thématique du PS Suisse ou de ton parti cantonal, ou encore dans l’une des sous-organisations telles que les Femmes socialistes, le PS Migrant-es, le PS 60+ ou le PS queer.
- Il y a aussi souvent la possibilité d’assumer une fonction interne au parti, par exemple au sein du comité de ta section.
- Si tu le souhaites discuter d’une candidature à une fonction publique, par exemple à la commission scolaire de ta commune, tu peux prendre contact avec ta section.
Afin de réaliser ses actions et son travail politique, le PS compte surtout sur l’engagement de ses membres. Mais la défense de nos valeurs nécessite aussi des moyens financiers.
Les cotisations des membres sont fixées, différemment, par les partis cantonaux et les sections locales et dépendent de ton revenu imposable. Nous suivons nos propres exigences politiques : celle ou celui qui gagne peu, paie peu, et celle ou celui qui gagne beaucoup, participe davantage aux coûts du parti et de sa politique.
En règle générale, les cotisations annuelles sont de l’ordre de 80 CHF pour les personnes à faible revenu et progressent à quelques centaines de francs pour les personnes à haut revenu.
Ces cotisations sont perçues annuellement.
Bien sûr ! Il n’est absolument pas nécessaire de posséder le passeport suisse pour pouvoir adhérer au PS.
Toute personne vivant en Suisse doit pouvoir participer aux débats politiques.
Tu as différentes possibilités de t’engager. Si tu veux être actif-ve au niveau local, adresse-toi à la section de ta commune de domicile.
C’est aussi le lieu le plus adapté pour t’engager dans une fonction publique ou un service au sein de l’administration (Conseil communal, Commission scolaire, Commission sociale…)
Tu peux également faire valoir ton savoir et ton savoir-faire en exerçant une fonction interne au parti. Le PS recherche toujours des personnes désirant s’engager dans l’organisation du parti (communes, districts, canton, commissions thématiques).
Il suffit de manifester ton intérêt aux responsables de ta section. C’est la section qui désigne les candidat-es du PS pour des fonctions publiques.
Ta section locale est souvent aussi le point de départ du processus de nomination interne au parti pour les candidatures au gouvernement cantonal (par exemple au Grand Conseil).
Aucune, excepté ta cotisation. Le partage de nos valeurs et de nos convictions est tout de même une condition préalable. Cela ne signifie pas pour autant de partager l’intégralité des positions du PS.
Les membres de la Jeunesse socialiste ont la possibilité d’adhérer gratuitement au PS jusqu’à l’âge de 26 ans. Une demande correspondante peut être envoyée par courriel à [email protected].
Les statuts du PS Suisse interdisent l’adhésion simultanée à plusieurs partis suisses.
Les doubles nationaux peuvent être membres du PS Suisse et d’un parti frère étranger, par exemple du SPD allemand ou du Partito Democratico italien. L’adhésion au PS Suisse est gratuite pour les membres de partis frères, pour autant qu’ils puissent prouver qu’ils versent une cotisation à un parti socialiste dans leur pays d’origine.
Oui, même à l’étranger, tu peux t’impliquer dans la politique en tant que membre du PS Suisse. Si tu es domicilié à l’étranger, tu deviens automatiquement membre du PS International.