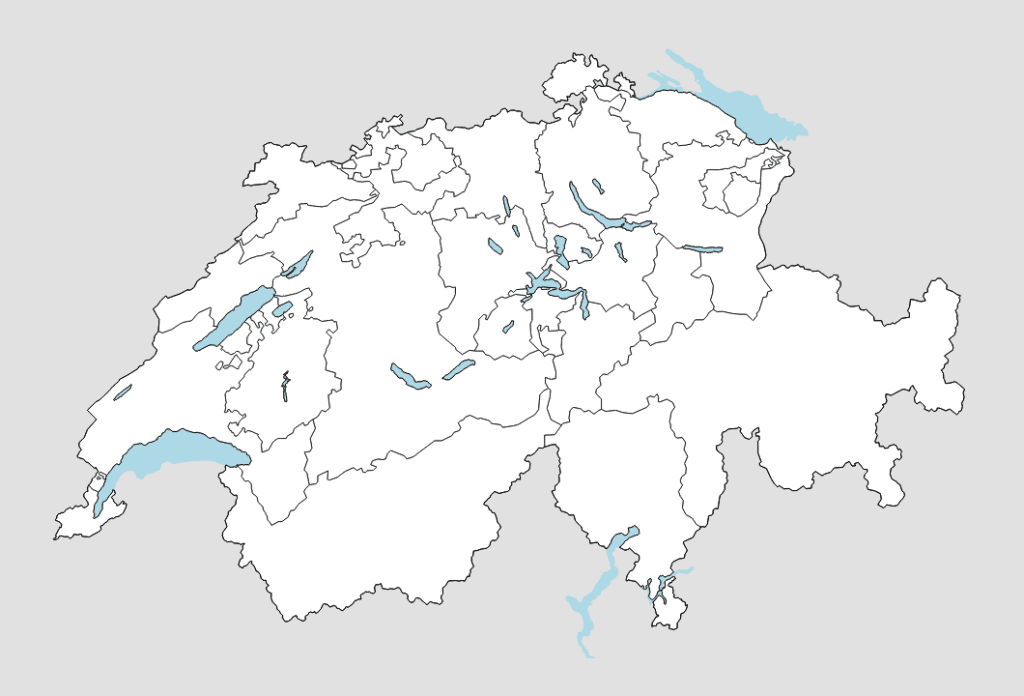Antrag:
Der Gemeinderat wird gebeten zu prüfen, in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei, unter Einbezug des FC Thun und mit wissenschaftlicher Begleitung das Prinzip des dialogorientierten Ansatzes im Management von Fussballfans (an Spieltagen, aber auch ausserhalb derer) zu initiieren mit dem Ziel, die Polizei- und Verwaltungskosten mittel- und längerfristig zu senken.
Begründung:
Die Polizeikosten für Einsätze bei Fussballspielen bewegten sich von 2013 bis 2017 zwischen 591’000 und 1,07 Mio., was einem Anteil an den polizeilichen Gesamtkosten zwischen 17,1 und 29% entspricht (2013: 29,3%, 2014: 17,1%, 2015: 21,5%, 2016: 21,6%, 2017: 22%, 2018: 20,37%). Das gemeinderätliche Ziel, den Betrag von max. 750’000/Jahr nicht zu überschreiten, wurde vier von sechs Mal nicht eingehalten.
Bis anhin hat der Gemeinderat auf Fehlverhalten der Fans vorwiegend mit einer Verschärfung der repressiven Massnahmen reagiert und verschiedene Handlungsoptionen im Rahmen des Hooligan-Konkordates verfügt. Dies hat sich jedoch als nicht zielführend erwiesen, weder konnten die Kosten gesenkt noch ein erwünschtes Fanverhalten bewirkt werden. Die repressiven Konzepte sind veraltet und es gibt weder wissenschaftliche Belege, noch Beispiele aus der Praxis, dass sie tauglich sind. «Dialog ist der einzige erprobte und wissenschaftlich belegte Lösungsansatz.» (Chief Superintendent Owen West von der West Yorkshire Police)
Ein Paradigmenwechsel würde dazu beitragen, nicht nur die Polizeikosten, sondern ebenso den Verwaltungsaufwand der Direktion Sicherheit zu senken und damit Ressourcen für andere Aufgaben zu schaffen.
Dank der dialogorientierten Strategie ist auch mit einer Verringerung von Straftaten zu rechnen. Andere Ursachen von deviantem Verhalten, die auf individueller Ebene liegen oder in Zusammenhang mit gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Umständen stehen, können mit dieser Strategie nicht behoben werden. Es kann daher nicht der Anspruch sein, alle Straftaten in Zusammenhang mit Fussballfans mit diesen Massnahmen verhindern zu wollen.
Mögliche ursächliche Gründe zahlreicher Zwischenfälle und Auseinandersetzungen, die mit dem dialogorientierten Ansatz beeinflusst werden können:
- Unverhältnismässiges oder taktisch fragwürdiges (z.B. Missachtung der nötigen Distanz) polizeiliches Verhalten
- Fehlende oder missverständliche Kommunikation
- Nicht ausreichende Bereitschaft der Stadtbehörden auf Fananliegen einzugehen und ein kaum vorhandenes Verständnis für das Wesen und die Dynamik der wohl grössten und aktivsten städtischen Jugendkulturszene
- Von der Fanszene als illegitim betrachtete Kollektivstrafen
- Fehlende Vertrauensbasis zwischen Fans einerseits und der Polizei und Stadtbehörden andererseits
Neue Strategie
Der dialogorientierte Ansatz im Management von Fussballfans soll in einem mehrjährigen (mindestens drei Jahre) Pilotversuch unter wissenschaftlicher Begleitung durch die Forschungsstelle Gewalt bei Sportveranstaltungen am Institut für Sportwissenschaften der Uni Bern durchgeführt werden.
Die Finanzierung müsste sichergestellt werden, z.B. durch Bund, Kanton BE, Stadt Thun, SFL.
Mehr über die Hintergründe und praxisnahe Erklärung des dialogorientierten Ansatzes sowie weitere Erkenntnisse über die Einflüsse auf Fanverhalten (z.B. Good Hosting bei den Einlasskontrollen) findet sich im Anhang, empfehlenswert sind insbesondere die Beispiele aus Stockholm und West Yorkshire (S.5-8). In West Yorkshire konnten dank dem sicherheitspolitischen Strategiewechsel die Polizeikosten nachweislich gesenkt werden.
Die Strategie in Stockholm und West Yorkshire wurden und werden wissenschaftlich begleitet. Die wissenschaftliche Evidenz für die Wirksamkeit dieser Ansätze ist klar vorhanden.
Einige mögliche Elemente des dialogorientierten Ansatzes:
- Einsatz spezifischer, polizeilicher Dialogteams mit fundierter Ausbildung. Die KaPo Bern verfügt bereits über Dialogteams und setzt diese auch ein. Was es aber bedarf, ist ein spezifisches « Dialogteam Sport », welches sich intensiv mit den Fans und der Fankultur auseinandersetzt und am Ball bleibt.
- Grundsatz in der Polizeitaktik: Ordnungsdienst-Einheiten im Hintergrund, Einsatz von Dialogteams im Vordergrund
- Immer die gleichen Personen der Sicherheitskräfte übernehmen die Dialogaufgabe, dadurch kann dank Beziehungsarbeit, Verlässlichkeit, klarer und offener Kommunikation Vertrauen hergestellt werden und der gegenseitige Informationsfluss wird verbessert und zuverlässiger.
- Trennung der Aufgaben und Kompetenzen zwischen den polizeilichen Dialogteams und den Spottern (Dialogteams: unbewaffnet und Verzicht von Anzeigen im Rahmen der Verhältnismässigkeit, soweit beides der rechtliche Spielraum zulässt)
- Die polizeilichen Dialogteams sind auch ausserhalb von Spieltagen unterwegs und suchen gezielt die Treffpunkte der Fans auf. Einerseits um in Beziehung zu treten, resp. die Beziehungen zu pflegen, andererseits um auf mögliches deviantes/unerwünschtes Verhalten wie Schlägereien im öffentlichen Raum, Sprayen, Tagen, Auseinandersetzungen mit privaten Sicherheitsdiensten etc. präventiv einzuwirken.
- Abkehr von Kollektivstrafen (z.B. keine Auflagen im Rahmen des Hooligan-Konkordates), die als grösste Kostentreiber bezeichnet werden können und die Gewaltspirale anheizen. Massnahmen, welche das Hooligan-Konkordat für Einzeltäter*innen vorsieht, wie Rayonverbote, Meldeauflagen, Ausreisesperren, bleiben bestehen.
- Übereinstimmende Grundsatzhaltung aller Stakeholder:
- Fans dürfen nicht pauschal als Kriminelle angesehen werden
- Fankurven funktionieren nach massenpsychologischen Prozessen und diese Dynamiken können entsprechend beeinflusst werden
- Das Verhalten der Polizei hat einen eminenten Einfluss auf das Fanverhalten
- Die Fans gelten als gleichwertige Gesprächspartner*innen
- Im Zentrum steht der vertrauensvolle Beziehungsaufbau zwischen allen Beteiligten
- Weiterbildung der mit dem Thema tangierten städtischen Mitarbeiter*innen im Umgang mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
- Einführung sozioprofessioneller Fanarbeit (u.a. als zentrale Vermittlungsstelle zwischen den Stakeholdern).
- Bereitschaft aller Beteiligten, die neue Strategie weiterzuverfolgen, trotz zu erwartenden Rückschlägen/Zwischenfällen.
Die dialogbasierten Ansätze gehen zurück bis zur EURO 2004. Die Strategie ist längst gesetzlich verankert. Einerseits in der klassischen schweizerischen Polizeitaktik (« 3D – Dialog, Deeskalation, Durchgreifen »), insbesondere aber auch im aktuellen « Übereinkommen des Europarats über einen ganzheitlichen Ansatz für Sicherheit, Schutz und Dienstleistungen bei Fussballspielen und anderen Sportveranstaltungen », welches gerade letztes Jahr vom Bundesrat verabschiedet wurde[1] oder siehe auch das originale Abkommen, vgl. v.a. Artikel 8.[2]
Ein Dialog-Ansatz ist in Thun mit der Arbeitsgruppe Prävention bereits vorhanden: Leitung durch Fanarbeit Schweiz, weitere Teilnehmende sind Fanvertretungen, FC Thun, Polizei Thun, Chef städtische Abteilung Sicherheit, Leiter städtische Fachstelle Kinder und Jugend.
Stakeholder:
- Fans
- Fanarbeit
- Polizei
- städtische Behörden
- FC Thun (inkl. Fanbeauftragte/r und Leiter*in Sicherheit)
- SFL
Die Stadt Thun würde sich aus mehreren Gründen für ein Pilotprojekt eignen:
- Zahlreiche Anhänger*innen der zwei gegnerischen Superleague-Clubs FC Thun und BSC YB wohnen im Einzugsgebiet und begegnen sich auch ausserhalb der Spieltage. Solche Begegnungen enden mehrfach in gewalttätigen Auseinandersetzungen im öffentlichen Raum.
- Die Auflagen des Hooligan-Konkordates wurden in Thun am Konsequentesten angewandt – ohne Rückgang der Zwischenfälle und ohne Verringerung der Polizeikosten.
- Thun hat eine überschaubare Grösse. Fussballfans und ihr Verhalten (Auftreten in Gruppen, Fanmärsche, Sprayen, Tags, Sticker) fallen auf und werden von einem grossen Teil der Bevölkerung als Problem wahrgenommen.
- Das Thema ist medial und politisch stark präsent.
- Es sind detaillierte Daten zur Erfassung der Ausgangslage vorhanden.
- Es bestehen Erfahrungen im Dialog, der aber von verschiedener Seite immer wieder abgebrochen wurde.
- Das Verhalten der Polizei Thun, insbesondere der Spotter (szenenkundige Beamte), wird von den Fans als ausgesprochen schikanös empfunden, es besteht eine grosse Abneigung und ein immenses (gegenseitiges) Misstrauen.
- Die Radikalisierung der Thuner Fankurve ist noch nicht so weit fortgeschritten, als dass kein Zugang zu ihr mehr möglich wäre.
[1] https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/news/2018/2018-06-272.html
[2] https://www.ejpd.admin.ch/dam/data/fedpol/aktuell/news/2017/2017-06-28/abkommen-e.pdf