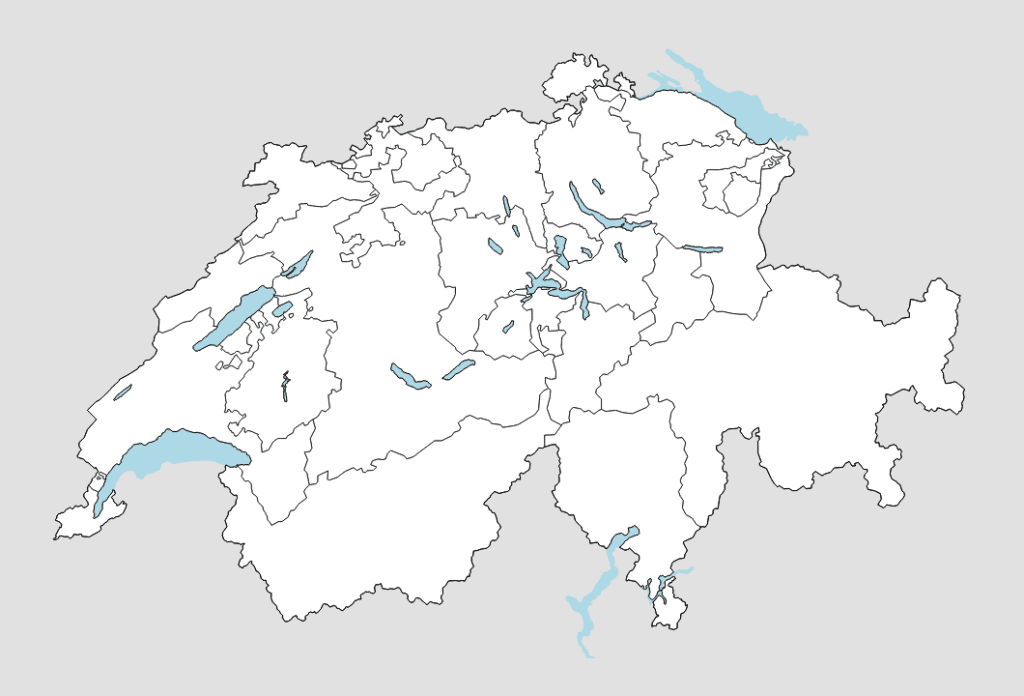Depuis plusieurs années, le Conseil d’Etat travaille à réduire les violences domestiques, et diminuer leurs conséquences sur les victimes. De nombreuses actions sont mises en place pour protéger les victimes mais aussi pour aider les auteurs des violences à modifier leur comportement. Il n’y a pas de doute que ces différentes actions participent à une amélioration générale de la situation. Cependant, malgré tous ces efforts, les violences persistent, et nous peinons toujours à amener les auteurs à une modification pérenne de la situation dans de nombreux cas.
Dans son rapport intitulé “Les chiffres de la violence domestique, années 2015 à 2023”, le Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes (BEFH) passe en revue les différentes actions et en mesure les effets au travers d’un compte-rendu chiffré. Ce rapport met en lumière plusieurs constats qui soulèvent plus de questions qu’ils n’apportent de réponses.
Si 72 % des demandes des victimes aboutissent à un premier entretien, on ne sait pas quelle fraction et quel type de situation amènent à un suivi par un ou plusieurs services. De manière générale, on ne sait pas dans quelle mesure le suivi des victimes et des auteurs est coordonné entre les différents services de l’état, afin d’assurer une perception commune de l’évolution de la situation, et quels efforts sont mis en place pour permettre, lorsque les deux parties le souhaitent, un accompagnement conjoint.
Si les chiffres sont utiles, une analyse plus qualitative des situations permettrait d’identifier des tendances communes ou des signes précurseurs de violence, pouvant ainsi guider de futures campagnes de prévention. De telles actions pourraient être menées auprès du grand public ou de partenaires spécifiques.
Effets à long terme des mesures :
Le rapport indique aussi que les interventions ont amené à des entretiens socio-éducatifs obligatoires avec 77 % des auteurs d’actes de violence ayant fait l’objet d’une ordonnance d’expulsion ces cinq dernières années. Mais que devient le 23 % restant, qui ne s’est pas présenté ? Un suivi à long terme est-il assuré ?
Par ailleurs, parmi les 320 auteurs ayant consulté une première fois, seuls 116 ont été suivis sur neuf mois. Quel accompagnement est prévu après cette période ? Existe-t-il un suivi à six mois, un an, trois ans ?
Enfin, combien de personnes expulsées ont pu regagner leur domicile et, parmi elles, combien ont retrouvé une situation stable et durable ?
Effets collatéraux sur les enfants et tiers
Le document se concentre sur les violences au sein des couples, mais il ne dit rien des tiers. Qu’en est-il des violences exercées sur les enfants ou sur des personnes dépendantes ? Lors des entretiens avec la victime directe, quelle place est-elle donnée aux tierces victimes collatérales de ces violences ?
Plus d’information sur le type de protection offerts notamment aux enfants, et leur impact sur le long terme par un suivi psychique ou physique nous apparait crucial.
Le rapport mentionne uniquement le suivi mère-enfant. Qu’en est-il du suivi père-enfant ? Même si les chiffres sont plus faibles, il est important de noter qu’en moyenne, 53 hommes ont été identifiés comme victimes de violences domestiques chaque année au cours des quatre dernières années (59 en 2020, 43 en 2021, 57 en 2022, 53 en 2023), représentant environ 20 % des cas signalés.
En conclusion :
Nous avons l’honneur de solliciter le Conseil d’État afin qu’une analyse soit réalisée, par exemple dans le cadre du prochain rapport du BEFH, pour évaluer l’impact du suivi mis en place et mieux comprendre les conséquences des violences domestiques sur les enfants à charge du couple.
Nous souhaitons en particulier :
Une analyse des chiffres de la récidive des auteurs, notamment en terme de :
- Nombre de récidives
- Aggravation ou réduction des violences
- Évaluation qualitative de l’impact du suivi mis en place, en particulier sur la prise de conscience et les changements de comportement des auteurs
Une analyse quantitative et qualitative de l’impact des violences domestiques dans le couple sur des tiers dépendants, notamment :
- Recensement des personnes impactées selon leur âge et sexe et du type de violences
- Analyse de l’impact à court et moyen terme des mesures de suivi mises en place par le département, sur les tiers concernés, notamment sur le cursus scolaire des enfants et sur les soins apportés aux personnes dépendantes